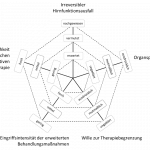Anna Bergmann
Der Tod überschreitet sämtliche Möglichkeiten des menschlichen Bewusstseins, ihn begreifen zu können. So bleibt auch der Begriff ‚Tod‘ in seinem metaphorischen Charakter eines Sprachbildes stecken. Denn alle Bemühungen, das Wort ‚Tod‘ zu verstehen, sind angesichts der Transzendenz des Todes zum Scheitern verurteilt: Versuchen wir „den Tod“ in Worte zu fassen, so der Philosoph Thomas Macho „wird uns die Tür vor der Nase zugeschlagen“.[1] Unser Erfahrungshorizont mit ‚dem Tod‘ beschränkt sich ganz allein auf unseren Umgang als Überlebende mit den Toten.
Verwandelt sich eine Person in einen Leichnam, stellt dieses Geschehen ein mächtiges Ereignis dar. Mehr noch: das Erlöschen der Existenz eines Menschen bleibt von Geheimnissen umhüllt. Und so zielen sämtliche Umgangsformen mit den Toten, die jemals von einer Kultur entwickelt worden sind, darauf ab, den Überlebenden etwas in die Hand zu geben, um die für immer auf den Kopf gestellte Beziehung zu den Verstorbenen bewältigen zu können. Wenn ein Mensch stirbt, befinden sich die Anwesenden in einer zuschauenden, ohnmächtigen Position. Das sich abspielende leibliche und geistige Erleben der Sterbenden und erst recht die Undurchdringlichkeit des Todes sind allen Versuchen zum Trotz, ‚den Tod‘ rational erfassen oder gar beherrschbar machen zu wollen, von Geheimnissen, Angst und Furcht umhüllt. Insofern bleibt der Tod allen aufklärerischen Versuchen zum Trotz nicht rationalisierbar.
Um nicht in einem dunklen Abgrund zu verharren, haben alle Kulturen spirituelle und religiöse Bräuche entwickelt, die einen Umgang mit der Unbegreiflichkeit des Todes ermöglichen. Sie eröffnen einen Spielraum, der tiefsitzende Ängste und die zugleich für immer erfolgte Trennung von einem geliebten Menschen lindern hilft. Daher wird die Beisetzung der Toten in soziale, magische und religiöse Rituale gefasst, die eine symbolische Kommunikationsform eröffnen. Mögen Sterbe- und Bestattungszeremonien in den einzelnen Religionen und Kulturen sich voneinander unterscheiden, so sind sie dennoch universal auffindbar und auch in unserer modernen Gesellschaft unverzichtbar geblieben.
Der Totenkult reguliert die vielfältigen Beziehungen der Lebenden einer Gemeinschaft zu ‚ihren’ Verstorbenen. Daher geht es in jeder Bestattungskultur um sehr viel mehr, als nur um die Beseitigung von toten Körpern. Im Zuge säkularer Entwicklungen sowie verstärkter Individualisierungsprozesse traten seit Ende des 20. Jahrhunderts zur religiösen Bestattungspraxis z. B. das anonyme Rasengrab, die Beerdigung in einem Friedwald und damit einhergehende Veränderungen der Friedhofsarchitektur hinzu.[2] Solche Liberalisierungen der Bestattungsbräuche sind zwar abgekoppelt von Konfessionszugehörigkeiten und einem Gottesglauben, dennoch beruhen sie auf Spiritualität und Ritualen. So knüpfen die seit den 1990er Jahren entstandenen neueren Bestattungsformen wieder an Vorstellungen über eine kosmologische Eingebundenheit sowie die Zyklizität von Leben und Tod an. Beispielsweise greift das Areal des Parks der Ruhe und Kraft auf dem Wiener Zentralfriedhof auf magische Symbole zurück – etwa auf die Spirale, das Labyrinth, das Quadrat oder den Kreis als Zeichen der kosmologischen Eingebundenheit in eine beseelte Natur.
Zu der religiösen sowie spirituellen Gestaltung des Sterbens und des Umgangs mit den Toten ist die moderne Medizin hinzugetreten. Parallel zu den bis heute praktizierten, uralten Traditionen ist sie für die kulturelle Wahrnehmung des Todes federführend geworden. Der medizinisch-naturwissenschaftliche Zugang ist davon geprägt, das Sterben sowie den Todeseintritt als bloße pathophysiologische Tatsachen zu beobachten. Die auf biologische Abläufe reduzierte Wissensform der modernen Medizin hat ihr in unserer Kultur immer mehr das Ansehen verliehen, die vorrangige Spezialistin des Sterbens und des Todes zu sein. Selbst vom Christentum, Judentum und vom Islam ist die medizinische Expertenrolle für den Tod unbestritten. Im Laufe des 20. Jahrhunderts erfolgte schließlich unter der Voraussetzung einer Medizinierung der Auffassung über das Sterben und den Todeseintritt auch eine zunehmende Verlagerung des Sterbens aus dem häuslich-familiären Bereich in das Krankenhaus.
Aber selbst wenn in medizinischen Räumen traditionelle Sterbezeremonien im 20. Jahrhundert in den Hintergrund getreten sind, ist dennoch in unserer säkularen Kultur der Moderne die spirituelle Beziehung zum Tod nicht wirklich aufgegeben und nicht zuletzt auch durch die internationale Hospizbewegung sehr lebendig geblieben.
Die Auffassung von einem absoluten Tod ist unseren Bestattungssitten nicht nur fremd, im Gegenteil: Sie dienen dazu, einen sozialen Kontakt und eine symbolische Kommunikation mit den Seelen der Verstorbenen herzustellen. Sämtliche magischen sowie religiösen Bräuche einer Beisetzung orientieren sich an der Vorstellung von einer Weiterexistenz der Seelen. Auch geht es in der Bestattungskultur immer darum, den Toten möglichst eine Ehrerbietung zukommen zu lassen.
Die hohe Bedeutung der Totenpflege kommt daher nicht weniger ausgeprägt im säkularen politischen Totenkult zum Zuge, etwa wenn in sozialistischen Ländern wie in der DDR sogenannte „verdiente Bürger“[3] auf dem Friedhof einen exponierten Platz und ein Ehrengrab erhielten oder wenn Kriegsparteien den Austausch von Toten verhandeln, um sie in die Heimatländer zu überführen und dort beisetzen zu können.
Auch moderne Rechtsordnungen gewähren einen Schutz nach dem Tode, der die Totenruhe und die körperliche Unversehrtheit des Leichnams versichert. Aus dem in Bestattungsgesetzgebungen verankerten Persönlichkeitsrecht, das die Wahrung der Menschenwürde über den Tod hinaus gewährleistet, leitet sich die Strafbarkeit der Störung der Totenruhe ab. Seiner hohen Bedeutung entsprechend sind Prinzipien der Totenfürsorge mit einer Bemächtigung des Leichnams unvereinbar. Dieser Grundsatz ist kein ureigenes Merkmal von sogenannten archaischen Gesellschaften und somit keine Frage, ob es sich um eine Kultur handelt, in der eher eine magisch-religiöse oder eine mehr weltlich akzentuierte Auffassung über den Tod vorherrscht. Die Zugehörigkeit von Verstorbenen zu einer Gemeinschaft, ihr Status als ‚eigene’, im Gegensatz zu ‚fremden Toten’, ist ausschlaggebend für die Verpflichtung zur Totenfürsorge. Hervorzuheben ist, dass Sterbeordnungen eine wichtige Unterscheidung zwischen den ‚eigenen Toten‘ und den ‚fremden’ Toten vorgeben.[4]
Vor diesem Hintergrund ist es in Tötungsriten des Krieges bis heute üblich, die (‚fremden’) Toten des Feindes zu zerstören, so dass die Totenruhe und ‑pflege verhindert und in ihr genaues Gegenteil verkehrt werden. Ebenso konnten in den frühneuzeitlichen Hinrichtungsritualen die Exekutionsleichen Opfer einer Zerstückelungszeremonie werden. Je höher die verhängte Strafe war, umso mehr wurde eine Totalvernichtung des Körpers angestrebt.[5] Solche interkulturell vorzufindenden Praktiken unterliegen ein- und derselben Logik des Totenkults: Während die ‚eigenen Toten’ zu pflegen und in ihrer Integrität zu bewahren sind, dürfen die ‚fremden Toten’ zu Objekten der Zerstörung und Schändung werden, um Verachtung und eine soziale Ausstoßung zu demonstrieren.
Ist der Tod eines Menschen eingetreten und hat sich das Sterbebett in ein Totenbett verwandelt, verändern sich die Beziehung zu dem gerade verstorbenen Menschen und die Atmosphäre im Sterbezimmer radikal. Für die Familie und den Freundeskreis beginnt eine neue Phase des Abschieds, in der nur noch symbolische und spirituelle Kommunikationsformen möglich sind.
Die weiterhin vorhandene leibliche Gegenwart eines toten Menschen kann für den letzten Abschied und die Realisierung seines Todes in der ersten Phase der Trauer von nicht zu überschätzender Bedeutung sein. Es gehört zur Profession von Bestattern, ebenso wie zu dem in einem Hospiz palliativmedizinisch ausgebildeten Personal, die Angehörigen in dieser extremen Gefühlssituation zu unterstützen. Die Leichenwäsche, das Herrichten und die Bekleidung der Toten sowie ihre anschließende Aufbahrung geben der aus den Fugen geratenen Beziehung zu einem gerade verstorbenen Menschen eine Orientierung. Die Herstellung einer neuen Ordnung ist umso wichtiger, als der Anblick der vertrauten Person, die sich nunmehr als Leiche offenbart, höchst zwiespältig ist, wie Thomas Macho verdeutlicht:
„Die Toten sind Anarchisten. Sie sehen niemand an, ihr Blick zeugt von merkwürdiger und strenger Distanz, ein ‚böser Blick’, der gefürchtet wird, weil er sein Gegenüber ‚durchschaut’ als wäre es gar nicht anwesend. Der Tote spricht nicht, und seine Miene bleibt verschlossen. Er bewegt keinen Muskel, zuckt nicht mit den Wimpern, rührt keinen Arm und kein Bein. Dennoch haben die Toten Augen, Münder und Zungen, Gesichter, Muskeln, Arme und Beine. Der Tote ist unzweifelhaft ein Mensch. Er ist menschlich und unmenschlich zugleich, äußerst vertraut und äußerst fremd“.[6]
Bestattungssitten unterstützen auf der einen Seite die Angehörigen, ihrer Trauer einen Ausdruck zu verleihen und andererseits die Notwendigkeit, eine klare Grenze zwischen der ‚Welt der Toten’ und der ‚Welt der Lebenden’ zu ziehen. Aus der ambivalenten Beziehung zu den Verstorbenen folgt das Bestreben, widersprüchliche Bräuche miteinander zu verknüpfen, sich einerseits den Toten gegenüber fürsorglich zu verhalten und andererseits sich von dem Leichnam durch Rituale abzugrenzen, – etwa durch das Verschließen der Augen oder die Öffnung der Fenster, damit die Seele im Haus nicht eingesperrt herumgeistern, sondern für immer an einen außerweltlichen Ort ins Jenseits verschwinden könne.[7]
Wie viele seiner Kunden geht auch der Bestatter Thomas von Hehl davon aus, dass die Toten eine Zeitlang noch gegenwärtig sind und „die Seele des Verstorbenen nicht in dem Moment weg ist, wenn der klinische Tod festgestellt werden kann. Das heißt, man verhält sich mit einer gewissen Ruhe und Pietät, die man vielleicht sonst nicht hat.“[8] Der Begriff ‘Pietät‘ stammt aus dem Lateinischen (lat. pietas) und bedeutet ‚dankbare Liebe’, ‚Ehrfurcht’. Er beinhaltet zwei sehr verschiedene Aufgabenbereiche, die nicht an religiöse oder spirituelle Vorstellungen gebunden sind: Pietät bezieht sich auf einen würdevollen Umgang mit den Toten, der auch in modernen Rechtsordnungen mit dem Persönlichkeitsschutz nach dem Tode gesetzlich verankert ist. Außerdem umfasst ‚Pietät’ den Schutz der Hinterbliebenen in ihrer Trauer. Sie räumt den Verwandten eine zu respektierende Tabuzone und das juristisch zugestandene Recht auf ein ehrerbietendes Totengedenken ein.
Die „heilige Scheu“ vor den Toten: Ihre Überwindung in der anatomischen Sektion für Zwecke der medizinischen Forschung und Lehre
Allein der modernen Medizin ist das Recht vorbehalten, den strafrechtlichen Schutz des Leichnams für gerichtliche, klinische, wissenschaftliche oder therapeutische Zwecke außer Kraft zu setzen. Dafür getroffene Ausnahmeregelungen berühren die Bestattungsgesetze und sind in Sektionsgesetzgebungen festgelegt. Sie umfassen die Obduktion, die klinische und anatomische Sektion (lat. sectio: Zerteilen) sowie die Organ- und Gewebe-Spende[9].
Die Obduktion dient der medizinischen oder forensischen Abklärung einer natürlichen bzw. nicht natürlichen sowie ungeklärten Todesursache. Die klinische und anatomische Sektion hingegen verfolgt einen von den Toten unabhängigen Zweck. Sie stellt eine Methode der naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung in der medizinischen Forschung sowie Ausbildung dar und setzt die schriftliche Einwilligung der verstorbenen Person voraus. Ein Mensch, der sich zu Lebzeiten freiwillig dazu entschlossen hat, seinen Körper nach dem Tode für die medizinische Ausbildung und für wissenschaftliche Zwecke zur Verfügung zu stellen, gilt im deutschsprachigen Raum als ‚Körperspender‘. Das Motiv für eine Körperspende ist häufig finanziell begründet, denn die Universitäten organisieren nach einer anatomischen Sektion eine Gedenkfeier und übernehmen die Kosten für die Einäscherung sowie die Urnenbeisetzung auf Grabstätten der Universitätskliniken oder auf Friedhöfen in den extra von der Anatomie eingerichteten Urnen- oder gar Ehrengrabanlagen.
Für eine anatomische Sektion ist eine schriftliche Vereinbarung obligatorisch, die nur von volljährigen Personen getroffen werden kann. Die anatomische Zergliederung gestattet eine „’Verwertung’ des Leichnams für medizinische Zwecke im weitesten Sinne“[10]: Ganze Körperteile dürfen zurückbehalten und die Toten in Ganzkörperpräparate umgewandelt werden. Die in Bestattungsgesetzen verankerten Ausnahmeregelungen für die Durchführung von Sektionen berühren außerdem die mit einer Zergliederung verbundene Organ- und Gewebegewinnung für therapeutische Zwecke. Auch sie sind von dem Rechtssatz des über den Tod hinauswirkenden Persönlichkeitsrechts von Patienten mit einem Hirnversagen (‚Hirntod‘) hergeleitet und begründen sich außerdem auf dem Selbstbestimmungsrecht der erklärten Körper- sowie Organ- und Gewebespender.[11]
Seitdem in den 1960er Jahren die Transplantationsmedizin sich der Weltöffentlichkeit als ein neuartiges, im größeren Maßstab anwendbares Therapieverfahren dargeboten hatte, wurden in westlichen und östlichen Industrienationen Transplantationszentren etabliert und seit den 1970er Jahren in Transplantationsgesetzgebungen für die Gewinnung von menschlichen Körperteilen zur therapeutischen Verwendung Sonderbestimmungen erlassen.[12] Sie erlauben eine Zergliederung für Verpflanzungszwecke im größeren Maßstab: die Entnahme von bis zu acht Organen (Nieren, Lungen, Herz, Leber, Bauchspeicheldrüse, Dünndarm) sowie von Gewebe – etwa Knochen (Beckenkamm, Röhrenknochen, Rippen etc.), Luftröhre, Haut, Bänder, Muskeln, Rippenknorpel, Faszien, Sehnen, Blutgefäße, Weichteilgewebe und mittlerweile aber auch von Beinen, Händen, Armen, Gesicht, Gebärmutter und Penis. Für die Einwilligungspflicht zu einer Organ- und Gewebeexplantation gibt es zwar national unterschiedliche Vereinbarungen (Widerspruchs‑, Informations‑, erweiterte Zustimmungsregelung), aber diese sind grundsätzlich großzügiger als eine Körperspende gesetzlich geregelt: In allen Ländern mit einer etablierten Transplantationsmedizin wird auf eine schriftliche Vereinbarung zwischen einer medizinischen Institution und ihren potenziellen Organspendern verzichtet. Noch nicht voll geschäftsfähige Minderjährige ab dem 16. Lebensjahr, die in diesem Alter kein schriftliches Testament für Wertsachen niederlegen dürfen, können sich ohne Absprache und unabhängig von der Einstellung ihrer Familienangehörigen zu Organspendern erklären.[13]
Da die Verpflanzungspraxis auf einer verengten Todesdefinition beruht, birgt die Organspende eine besondere Problematik in sich. Die Kennzeichnung einer als ‚postmortal‘ geltenden Multiorganexplantation leitet sich von der Hypothese ab, aufgrund eines Gehirnversagens sei nur die Person, nicht aber ihr Körper tot. Auf Grundlage dieser Todesvorstellung bleibt die Organgewinnung aus dem lebenden Körper von Organspendern von den Straftatbeständen der vorsätzlichen und fahrlässigen Tötung sowie der Körperverletzung unberührt. Das heißt, im Status eines Leichnams gilt zunächst nur, dass mit dem Eintritt des ‚Hirn‘-Todes der strafrechtliche Schutz der Totenruhe und das Recht der Angehörigen auf Wahrung der Pietät wirksam wird. Bei einer Organspende jedoch ist der Persönlichkeitsschutz relativiert, denn er ist überlagert von dem Selbstbestimmungsrecht. Dieses wird rechtswirksam, sollten Intensivpatienten mit einem Hirnversagen zu Lebzeiten einer Organspende zugestimmt und somit ihre Totenrechte aufgegeben haben.[14]
Das auf ein Organ – das Gehirn – reduzierte Todeskonzept veranlasste 1968 einen der großen Philosophen des 20. Jahrhunderts Hans Jonas (1903 – 1993) dazu, die Organentnahme bei lebendigem Körper in die Tradition der anatomischen Sektion von lebendigen Tieren zu stellen. [15] Die Tiervivisektion wurde im 17. Jahrhundert als neuartige Erkenntnismethode von dem französischen Philosophen René Descartes (1596 – 1650) mit der Hypothese legitimiert, Tiere seien aufgrund ihrer Hirnbeschaffenheit unfähig, zu fühlen und zu denken. Diese Argumentationsfigur stellte Jonas in seiner Hirntodkritik in den Zusammenhang der transplantationsmedizinischen Organgewinnung aus lebenden Körpern im Sinne einer Vivisektion.
Hervorzuheben ist, dass die Hirntoddefinition aus rechtlicher, ethischer und auch medizinischer Perspektive umstritten geblieben ist. Denn die Kontroverse, ob bei Patienten mit einem Hirnversagen (‚Hirntote’) der Schutz des Lebensgrundrechts entfallen darf und ob dieses Todeskonzept juristisch tragfähig ist, ist bis heute nicht beendet.[16] Auf jeden Fall aber legitimieren Transplantationsgesetzgebungen unter der Voraussetzung, dass ‚der Hirntod‘ medizinisch festgestellt ist, die Organe bei lebendigem Körper zu gewinnen, so dass die Organspende noch sehr viel weitreichendere Konsequenzen als die Körperspende hat.
Die Existenz von Ausnahmebestimmungen für die Durchführung einer anatomischen Sektion sowie für die Organ- und Gewebespende verweist auf die hohe Bedeutung der Totenfürsorge auch in modernen Gesetzgebungsstaaten. Sie geht zwar auf die Tradition monotheistischer sowie naturreligiöser Gebote zurück, die den Leichnam mit einem Tabu belegt haben. Der Begriff ‚Tabu‘ leitet sich aus dem Polynesischen ab und hat die Bedeutung von ‚unberührbar‘. Sigmund Freud (1856 – 1939) weist auf die Besonderheit des Tabus in seiner ambivalenten Wortbedeutung hin: es schließt zum einen die Heiligkeit, zum anderen aber auch das Unheimliche ein.[17] Dieses Wesensmerkmal legt zunächst die Vermutung nahe, das Tabu sei ein archaisches Relikt aus vormodernen Zeiten. Aber auch im Gesetzgebungsstaat, in dem das Recht nicht mehr auf einer religiösen oder gar ‚heiligen’ Begründung fußt, beruht – wie beispielsweise die im deutschen Grundgesetz garantierte Menschenwürde – auf einem Tabu: dem Berührungsverbot. Denn die Menschenwürde gilt als unantastbar.[18] Der Rechtswissenschaftler Otto Depenheuer verweist auf dieses Paradox und erklärt: „erst Tabus ermöglichen Rationalität“.[19] Sie dienen in modernen Gesellschaften insbesondere dem Schutz von Kindern, schwachen, kranken oder sterbenden Menschen.
Alexander Mitscherlich (1908 – 1982) griff 1963 den von Sigmund Freud 1912 geprägten Begriff „heilige Scheu“[20] auf, um die Überschreitung des Todestabus im Rahmen einer Leichensektion zu beleuchten. Die von Mitscherlich als Medizinstudent in seiner Ausbildung selbst erlebte Scheu vor dem Leichnam scheint ein universal auffindbares Phänomen und vermutlich anthropologisch verankert zu sein. Seit der Einführung der Leichenzergliederung im 16. Jahrhundert stellt die „heilige Scheu“ eine große kulturelle Barriere dar, so dass die anatomische Überschreitung des Todestabus bis zu Beginn des 18. Jahrhunderts fast ausschließlich an ‚fremden Toten’ erfolgte: Sektionen durften nur unter der Voraussetzung durchgeführt werden, dass es sich entweder um ‚fremde Tote‘ handelte, die aus entfernten Regionen, nicht christlichen Kulturen und Religionen stammten (z.B. jüdische Bevölkerung, Sinti, Roma) oder um Exekutionsleichen, die zuvor einer nach christlichen und strafrechtlichen Regeln organisierten Hinrichtung aus der Gemeinschaft rituell ausgestoßen worden waren.[21]
Seit dem 18. Jahrhundert wurde im Zuge des Aufstiegs der modernen Medizin der Kreis von genehmigten Sektionsleichen um Verstorbene aus dem Armutsmilieu, Kolonialgebieten sowie aus Gefängnissen, Zucht- und Arbeitshäusern erweitert. Offensichtlich konnte auch weiterhin die heilige Scheu nur an Toten, die nicht aus der Wir-Gruppe stammten, überwunden werden. Aber die naturwissenschaftliche Erkenntnisgewinnung der Leichensektion kam nicht ohne religiöse Rituale aus: Jede öffentliche Leichenzergliederung wurde gleichsam als eine sakrale Handlung für die Überwindung der heiligen Scheu vor dem Leichnam inszeniert, christlich gestaltet und damit auch das Bündnis mit der himmlischen Macht gesucht: Die Zergliederungszeremonie endete mit einer Totenmesse, einem christlichen Begräbnis der Sektionsopfer und mancherorts mit einem Leichenschmaus. Somit versuchte man sich nach einer Anatomie mit der Seele des Zergliederungsopfers zu versöhnen, indem es nach allen Regeln der Totenfürsorge beerdigt wurde, was einem hingerichteten Menschen sonst grundsätzlich verwehrt blieb.
Zudem schien über Jahrhunderte hinweg die heilige Scheu vor den Toten nur im Rahmen einer zeremoniellen Inszenierung im Anatomischen Theater coram publico überwindbar.[22] Zugang zu diesem Todesspektakel hatten neben den Gelehrten exklusiv Priester, die gesellschaftliche Élite sowie ‚ehrbare’ Bürger und Bürgerinnen. Unteren Schichten blieb der Besuch des Anatomischen Theaters verwehrt. Aber die Abschirmung dieser Zergliederungspraxis vor dem gemeinen Volk konnte Tumulte nicht verhindern. Proteste gegen die medizinische Bemächtigung von Toten begleiten die Geschichte der Anatomie seit ihrer Begründung im 16. Jahrhundert. Und so kam es immer wieder zu Skandalen: Zum Beispiel drangen 1622 Bewaffnete in das Anatomische Theater in Paris ein und nahmen die zur Sektion bestimmte Leiche in Besitz oder 1725 stürmte in Edinburgh eine Menschenmenge den Anatomiesaal, nachdem immer mehr Fälle des Leichenraubes vom städtischen Friedhof für Sektionszwecke bekannt geworden waren.[23]
Solche Konflikte zwischen Hinterbliebenen und Anatomiekammern dokumentieren die epochenübergreifend zu beobachtende Kollision der medizinisch-naturwissenschaftlich motivierten Leichenzergliederung mit den Grundsätzen der Pietät und Totenfürsorge. Nicht zuletzt blieb auch im 21. Jahrhundert die von dem deutschen Anatomen Gunther von Hagens weltweit auf Tournee geschickte Leichenausstellung „Körperwelten“ umstritten und sorgte für heftige Turbulenzen.
Skandale um die Verwendung von Toten für die medizinische Erkenntnisgewinnung werfen ein Licht auf das Problem der Leichenbeschaffung, das die Anatomie seit ihrer Begründung in der Renaissance begleitet. In ihnen offenbart sich ein Tabubruch, der bis zum heutigen Tag in jeder Generation angehender Ärztinnen und Ärzte nur ritualisiert überwindbar zu sein scheint. Denn solch heftige körperliche Reaktionen wie Ekel, Ohnmacht oder Erbrechen werden durch die anatomische Zerstörung ausgelöst:[24]: „Der Medizinstudent, der zum ersten Mal den Präpariersaal mit seinen zerstückelten Leichen betritt und gegen Schwindel-Ekel zu kämpfen hat, wird Zeuge einer Tabuverletzung und weiß, dass von ihm erwartet wird, selbst das Tabu zu übertreten. Hier wird die ‚heilige Scheu’ vor den Toten durch ein Tun verletzt, das sich zwar auf hohe Absichten berufen kann […], sich aber keineswegs so gewiß ist, daß nicht elementare Gefühlsregungen den bewussten Vorsatz durchkreuzen könnten.“[25]
Die Überwindung der „heiligen Scheu“ vor dem Leichnam muss erlernt werden. Die englische Chirurgin Pauline W. Chen berichtet über ihr Schlüsselerlebnis des auch von ihr so gekennzeichneten rituellen Charakters des Präparationskurses. Er folgt einem immer gleichen Ablauf: „vom ersten Schock des Sezierens“[26] zu einer sanften Eskalation bis zur Routine. Marie Bayer, Medizinstudentin an der Berliner Universitätsklinik Charité, schildert die gängigen Anfangsschwierigkeiten: „Erstes Reinschnuppern, die erste Begegnung mit dem Tod – nicht alle halten das aus. ‚Ich setze mich kurz hin’, sagt eine Studentin am Präparationstisch, da wird sie ohnmächtig. Wenig später kommt sie angeschlagen zurück. ‚Surreal ist das mit der Leiche. Ich hoffe, ich gewöhne mich daran.’“[27]
Im Laufe des Sektionskurses wird geübt, diese Gefühlswelt zu verlassen, bis das wissenschaftliche Interesse Oberhand nehmen kann. Den Auftakt bildet die Konfrontation mit dem Leichnam ohne Ansehen des Gesichts. Es wird entweder verhüllt oder der Körper liegt auf dem Bauch mit dem Kopf nach unten.[28] Möglichst nichts soll aus dem Leben des Sektionsopfers ins Bewusstsein der Sezierenden dringen. Die amerikanische Ärztin Ellen Lerner Rothman stellt in ihren Erinnerungen an ihre Ausbildung an der Harvard Medical School fest, wie wichtig die Entpersonalisierung der Toten für sie war: „Ich wollte einfach nicht mehr wissen, als ich schon wusste. Es wäre zu schmerzhaft, Organ für Organ zu sezieren und dabei die Beziehung zu ihr […] zu empfinden.“[29] Wie einst in der Geschichte der Anatomie scheint auch in der heutigen medizinischen Ausbildung die Fremdheit der Toten eine zentrale Rolle für die Verletzung des Todestabus zu spielen. Die Herstellung einer maximalen Anonymität des zu zergliedernden Leichnams ist unverzichtbar geblieben, um den ersten Schritt zur Tabuüberschreitung wagen zu können. Marie Bayer beschreibt die nächste Stufe: „Aus einem großen Plastikbehälter holt eine Tutorin eine Lunge, dann einen halben Kopf. Längs geteilt, mit Kleinhirn, Großhirn, Augapfel und 30 Zentimetern Wirbelsäule, die daran hängt. Die meisten schrecken zurück.“[30]
Die „heilige Scheu“ vor dem Leichnam, die sich zunächst reflexartig vor das Erlernen des Arztberufes im Anatomiekurs stellt, kann nur durch eine Rationalisierung aller Gefühlsregungen überwunden werden. Apathie – das gewünschte Ergebnis der zur Routine gewordenen Unterdrückung von jeglicher Emotion – erzeugt den professionellen Zugang, denn es geht um nichts weniger, als um die „absichtliche Verstümmelung des Körpers eines anderen menschlichen Wesens“[31], wie die englische Historikerin Ruth Richardson erklärt.
Und so wird die rituelle Einübung des Sektionshandelns seit der Renaissance-Anatomie bis auf den heutigen Tag mit einer sakralen Zeremonie und Bestattung beschlossen. Sie strebt eine Wiedergutmachung vor allem durch den Versuch einer fiktiven ‚Repersonalisierung’ der zergliederten Leichen an. Entsprechend brachte das anatomische Gedenkritual der Medizinstudentin Marie Bayer eine große Erleichterung. Sie schildert den Gang eines solchen Sektionszeremoniells, „wie sie stets von StudentInnen zu Ehren der KörperspenderInnen organisiert wird, als Dankeschön […]. Der Charité-Chor stimmt ‚Ave Maria’ an […]. Über die Leinwand laufen die Namen der KörperspenderInnen, für jede und jeden wird eine weiße Rose auf den Tisch gelegt, bis sie einen Kreis bilden. ‚Ursula H., Eleonore B., Detlef K., Vera L., Inge P.’ 36 Namen.“[32]
„Gewisse Gefahren, die aus der Verletzung eines Tabus entstehen, können durch Bußhandlungen und Reinigungszeremonien beschworen werden,“[33] kommentiert Sigmund Freud solche Wiedergutmachungsrituale nach der Überschreitung eines Tabus.
Die Überwindung der „heiligen Scheu“ bei der Gewebe- und Organgewinnung
Ein von allen spirituellen Beziehungen befreites, nacktes Verhältnis zu Sterbenden und Toten verlangt das Transplantationssystem gegenüber Organspendern und ihren Hinterbliebenen. Im Gegensatz zur Körperspende ist die Organ- und Gewebeexplantation in kein medizinisches Ritual eingebettet, das die eigentliche Verwertung von Organspendern noch in Erinnerung rufen könnte. Organentnahmen sind in den Krankenhausalltag integriert und spielen sich exklusiv als medizinische Arbeit im Rahmen eines chirurgischen Eingriffs ab. ‚Hirntote’ Patienten gelten als verstorben und werden mit einer ärztlichen Todesbescheinigung von der Intensivstation in den Operationssaal gefahren. Ganz anders als bei einer anatomischen Sektion ist die Organisation der Organgewinnung durch einen extrem hohen Grad der Arbeitsteilung gekennzeichnet.[34] Bei einer teilweise bis zu acht Stunden dauernden Multiexplantation sind Organ für Organ, anschließend Gewebe für Gewebe arbeitsteilig zu entfernen, zu konservieren und jeweils an verschiedene andere Orte zu verfrachten. Diese in viele Arbeitsschritte zerlegten, körperverwertenden Tätigkeiten geben eine eigene Operationslogistik vor, die von Transplantationskoordinatoren zeitgenau zu organisieren sind.
Wie bei jeder anderen Operation, arbeiten vier verschiedene Berufsgruppen an einer Organexplantation mit: die in der Klinik diensthabenden Anästhesisten, Operationspflegekräfte, eine Instrumentenschwester oder ein Instrumentenpfleger aus dem Entnahmekrankenhaus und die von außen kommenden Chirurgen. Die auf ein bestimmtes Organ spezialisierten Entnehmer reisen in der Regel aus Transplantationszentren, im Eurotransplant-Verbund auch aus anderen Ländern, an. Das heißt, Chirurgen kommen und gehen im Laufe einer Organexplantation. Die anschließende Gewebegewinnung von z.B Blutgefäßen, Venen, Haut oder Knochen kann noch drei Tage nach dem Herz-Kreislaufstillstand von Spendern erfolgen und steht nicht unter dem Zeitdruck wie eine Organexplantation bei lebendigem Körper, so dass sie je nach Umfang nicht unbedingt im Operationssaal durchgeführt werden muss, sondern auch in Sektionssälen der anatomischen, pathologischen oder gerichtsmedizinischen Institute der jeweiligen Kliniken stattfinden kann.[35]
Wie schon im Präparierkurs die Entpersonalisierung der Sektionsopfer eine wichtige Voraussetzung für den Schritt zur Zergliederung bietet, ist auch die chirurgische Entfernung der Organe so arrangiert, dass sie von menschlichen Hemmungen möglichst nicht blockiert wird. Normalerweise hat niemand von den Chirurgen die betreffenden Spender jemals zuvor zu Gesicht bekommen, denn sie betreten den Operationssaal als Fremde.
Die bei einer Explantation assistierenden Fachkrankenpflegekräfte hingegen beherrschen die nunmehr geforderte Verdrängungsleistung am wenigsten. Sie haben keinen Sektionskurs besucht, keine Routine in der Überschreitung des Todestabus und arbeiten an der Organgewinnung von Anfang bis zum Ende mit. So veranschaulicht ein Fachkrankenpfleger, wie ihn Ekel überkam, als Gelenke eines Spenders explantiert wurden, „weil da einfach alles aufgeschnitten und ausgenommen wird. […] Wenn dann die ganzen anderen Teile noch mit herauskommen, dann ist das nur noch eine Hauthülle. Manchmal habe ich mich gefragt: ‚Was ist der Unterschied zwischen mir und dem Huhn auf der Schlachtbank‘ – um es einmal bildlich auszudrücken. […] Auch die anderen Sachen, also wenn sie mit Hammer und Meißel an einen Toten herangehen und handwerklich tätig sind, das hat für mich noch eine andere Qualität.“ [36] Welche Empfindungen das Bild eines ausgeräumten, toten Menschen am Ende hervorrufen kann, veranschaulicht der Anästhesist Dr. Marek Brodezky: „Wenn dann nur noch ein Loch ist, fühlt sich das grauenvoll an. Das brennt sich als Bild ein, wenn da nur noch ein Loch ist.“[37]
Keine Stelle des Körpers von Organ- und Gewebespendern muss verschont bleiben. Dabei handelt es sich um die größte Operation, die von der Chirurgie jemals entwickelt wurde. Die Viszeralchirurgin Dr. Andrea Müller veranschaulicht die Dimension dieses Eingriffs am Lebensende von Organspendern: „Man sieht […] sehr viel Anatomie, so gut, wie man sie sonst nie sieht.“[38] Aber im Gegensatz zu Anästhesisten und dem Fachkrankenpflegepersonal erleben Chirurgen die Organgewinnung durch ihren hohen Grad der Arbeitsteilung als nicht belastend. So hat der Herzchirurg Dr. Matthias Loebe während seiner Laufbahn weit über 200 Herzen entnommen. Für ihn ist diese Operation seelisch ein ‚leichtes Spiel‘, denn er ist in die Explantation nur minimal involviert: „Ein Chirurg und speziell derjenige, der das Herz entnimmt, kommt in eine Klinik, wo man mit dem Spender als Person nicht viel zu tun hat. Denn man kommt dorthin, der Brustkorb, der Bauch sind eröffnet, so daß man keine direkte Konfrontation hat.“[39] In der Regel betritt Loebe erst dann den Operationssaal, wenn andere Teams das Herz bereits freigelegt haben, und dann „ist die Herzentnahme eine Operation, die vielleicht 15 oder 20 Minuten dauert“.[40] Die Patienten verschwinden unter einem Tuch, das sie verhüllt: „Wenn Sie eine abgedeckte Fläche haben – das ist wie ein Tischtuch, worin ein Loch ist,“[41] erklärt ein Fachkrankenpfleger.
Organexplantation: Die Berührung des Tötungstabus
Die Ärztin und Psychotherapeutin Dr. Hiltrud Kernstock-Jörns erläutert, warum die Anonymität der Spender für Chirurgen unverzichtbar ist. „Ich denke, das ist etwas, was nicht geleistet werden kann im Rahmen eines doch sehr tiefsitzenden und schmerzhaften Schuldgefühls. So sagt auch unsere Sprache so treffend: ‚Dem kann ich nicht mehr ins Gesicht schauen.‘ Ich glaube, in dieser kleinen Handlung, daß man den Explantierten nicht anschauen will, drückt sich deutlicher als in manchen Erörterungen aus, wie tief doch ein Gefühl des Schuldseins in den Chirurgen sitzt.“[42]
Das von Dr. Kernstock-Jörns vermutete und durch das Prozedere der Organgewinnung entstehende Schuldgefühl hat seine Quelle nicht allein in der Überschreitung des Todestabus. Denn die Explantationstätigkeit berührt außerdem das Tötungstabu. Schließlich erfolgt die Zergliederung von Organspendern im lebendigen Zustand. So fixiert die Hirntoddefinition den Tod eines Menschen auf ein einziges Organ – das Gehirn – sowie einen einzigen Zeitpunkt.[43] Sie suggeriert einen Tod ohne Sterben. Der prozesshafte Charakter des Sterbens wird somit im biologischen Sinne, aber auch als ein soziales, hochdramatisches und transzendentes Ereignis verleugnet.
Für unser Verständnis einer Organspende sei die grundlegende Differenz von drei verschiedenartigen Phänomenen in Erinnerung gerufen: der Metapher Tod, einem sterbenden Menschen und einem Leichnam. Erst mit dem Eintritt des Todes verwandelt sich eine sterbende in eine tote Person. Dieser einzigartige Moment markiert, wie Thomas Macho treffend formuliert: „den Auftritt des Toten“[44]. Die prinzipielle Unterscheidung zwischen einem lebendigen sterbenden Menschen, einer Leiche und ‚dem Tod‘ in seinem undurchdringlichen, transzendenten Charakter löscht die Hirntod-Semantik rhetorisch aus, wenngleich im Gegensatz zu den Bezeichnungen ‚sterbender‘ und ‚toter Mensch‘ der Todesbegriff auch im naturwissenschaftlichen Sinne weiterhin nur, wie Macho hervorhebt, „eine Chiffre für ein dunkles Rätsel“[45] bleiben kann und die maximaltherapeutische Weiterbehandlung von ‚hirntoten‘ Organspendern für den Zweck der Explantation auf nichts anderes abzielt, als sie mit allen denkbaren Methoden der Intensivmedizin am Leben zu erhalten.
Diese Aufgabe übernehmen bei der Organgewinnung die Anästhesisten, denen jene von Chirurgen gescheute persönliche Konfrontation mit Organspendern nicht erspart bleiben kann. Der Anästhesist Dr. Marek Brodezky präzisiert den gravierenden Unterschied zwischen der Tätigkeit von Entnehmern und seinem Aufgabenfeld: „Ich kenne es eben nur so, dass ein Chirurg irgendwo hinfliegt und dort z. B. ‚sein Herz’ holt – wie auf einem Beutefeldzug. Das ist schon klar, dass die Chirurgenteams immer wieder wechseln und dass wir Anästhesisten den Trubel hinter dem Vorhang lassen. Ich habe so mein kleines Reich, das hat den Nachteil, dass es am Kopfende ist. Die Beziehung erfolgt ja über das Gesicht. So perfekt abspalten, dass ich den Patienten als ein anatomisches Präparat wahrnehmen könnte, das geht nicht, denn mein Patient hat ein Gesicht. […] Für uns Anästhesisten sind es immer die eigenen Patienten.“ [46]
Diese anästhesiologische Betreuung verdeutlicht, dass es nach der ärztlichen Hirntodfeststellung von Intensivpatienten mit einem Hirnversagen keinen Auftritt von Toten gibt. Denn die Verwandlung von Organspendern in Leichen erfolgt auf dem Operationstisch im zuvor bescheinigten Status von ‚Kadaverspendern‘ am Ende einer Explantation. So schlägt das Herz von Hirntoten, ihre Lungen atmen mit technischer Hilfe, sie verdauen, scheiden aus, wehren Infektionen ab, haben eine intakte Blutgerinnung, schütten Stresshormone aus und sie sind bis zu 17 Reflexbewegungen in der Lage – etwa Wälzen des Oberkörpers, Hochziehen der Arme, Beine und Schultern.[47]
Zu Beginn einer Organentnahme sind es in der Regel die Anästhesisten, die festlegen, wie mit einer sich bewegenden Leiche umzugehen ist. „Manche Kollegen sagen, man sollte Fentanyl geben, um auf spinaler Ebene Reflexe zu unterdrücken. Fentanyl ist ein Opiat. Das ist immer wieder eine Diskussion wert (…), weil der eine oder andere sagt: ‚Warum ein Opiat? Das ist doch ein Toter!‘“[48], erklärt eine Anästhesistin diese Situation.
Bevor Organspender vom Brust- bis zum Schambein aufgeschnitten werden, erhalten sie aber auf jeden Fall Medikamente zur Unterdrückung von Muskelbewegungen. Sobald das Blut durch die kalte Nähr- und Kühllösung gegen Verwesungsprozesse ausgetauscht wird und die eiskalte Flüssigkeit in die Spender dringt, können sie mit Schwitzen, Hautrötungen, Anstieg von Blutdruck, Herzfrequenz oder Zuckungen reagieren.[49]
Das Tötungstabu wird dramatisch verletzt, sollten professionell Beteiligte den Hirntod nicht als Tod des Menschen wahrnehmen: „Wenn der Patient zwar definitorisch für tot erklärt ist”, so Günther Feuerstein, „in Wirklichkeit aber noch leben würde, läge die offensichtliche Unmoral darin, ihn als Leiche zu behandeln und dadurch de facto zu töten”.[50] So äußert eine Operationsschwester: „Man muß sich immer sagen, wenn die Tür aufgeht und der Patient reingeschoben wird, kommt ein toter Patient rein, sonst würdest du letztendlich mit deinem Team einen Mord begehen.“[51] Eine Anästhesieschwester schildert die besondere Atmosphäre im Operationssaal, wenn Organspender den Herztod erleiden und sich in eine Leiche verwandeln: „Vorher ist man beschäftigt und gibt dem Patienten Medikamente. Und dann kommt irgendwann der Augenblick, in dem der Patient sehr viel Blut verliert, und man schaut zu, wie das Herz aufhört zu schlagen. Für mich ist diese Situation furchtbar.“[52]
Die transplantationsmedizinische Rhetorik offenbart die per se fremdnützige Beziehung zu Organspendern: Transplantationskoordinatoren offerieren diese Intensivpatienten in ihrer Kommunikation mit der internationalen privatrechtlichen Stiftung Eurotransplant (Leiden)[53] unter dem Begriff ‚Organangebot‘. Diese entmenschlichende Sprache verrät den verwertungsorientierten Blick auf sterbende Patienten, wie auch der transplantationsmedizinische Jargon, wenn z.B. von einem „lebenden Restkörper“, „Herz-Lungen-Paket“[54] oder einem „lebenden Zellbestandteil“[55] die Rede ist. Solche Begriffe erzeugen eine Mentalität, die sterbende Menschen nicht mehr als uns zugehörig, sondern als ‚fremde Tote‘ wahrzunehmen und entsprechend zu vernützlichen erlaubt.
Der Akt der medizinischen Bemächtigung kann auch in ein rassistisches Wahrnehmungsmuster münden. Exemplarisch dafür sind die von dem Transplantationskoordinator der DSO Berlin-Brandenburg Dr. Peter Berning in Prosaform geschilderten Empfindungen als sich die Organspenderin Ekaterina Petrowna während ihrer Explantation in eine Leiche verwandelte. Seinen sexuellen Phantasien über den Augenblick des Sterbens und die Transformation seiner Patientin in einen Leichnam ließ Berning freien Lauf:
„Erst nach Einsetzen der Perfusion [Entblutung der Organe mit einer Kühl- und Nährflüssigkeit vor der Explantation] war sie wieder schön, das Gesicht schmal und blaß. Natürlich. […] Es war das erste Mal, daß ich in ein blutleeres Gesicht blickte und dieses schöner war als zuvor. […] Der Monitor macht Alarm. Die Kreislaufwerte sind zu niedrig. Ich erhöhe die Medikamentendosis […]. Die da liegt, deren Gesicht so aufdringlich leuchtet, weil zu vulgär geschminkt, die ist tot. Sie ist dennoch beatmet, immer noch durch einen Kreislauf mit Blut versorgt, kopfabwärts, richtiger müßte man sagen hirnabwärts. Ihr Thorax ist eigentümlich breit, so daß die Brüste wie Schutzschilder erscheinen, obwohl sie wahrscheinlich überdurchschnittlich groß sind. Der ganze Körper ist von tiefer und unnatürlicher Bräune. […] Ihr Typ kommt an, sie hat diese eurasischen Züge, hohe Wangenknochen, Mandelaugen, ein etwas geheimnisvolles Gesicht mit sehr schwarzen, blauschwarzen Haaren. Sie ist überall rasiert und die scheinbar makellose Haut schmerzt, weil sie so falsch ist. Die Beine sind etwas zu dünn für meinen Geschmack, zumindest im Verhältnis zum Becken und der sehr breiten, plattenartigen Brust. […] Ich faxe ein Foto nach Rußland zur Mutter, damit sie ihre tote Tochter identifizieren kann. Durchgepixelt, schwarzweiß gewinnt Ekaterina Petrowna wieder etwas von ihrer Zartheit zurück. Vielleicht steht ihr wirklich die Farbe nicht, vielleicht ist es nur mein persönlicher Geschmack. Ich kann nicht verheimlichen, daß ich sie abstoßend finde. […] Um die Organe entnehmen zu können, werden die großen Blutgefäße angestochen und mit eiskalter Nährlösung durchgespült. Das ist die Perfusion, die Organe müssen blutleer sein, damit man sie transplantieren kann und naturgemäß ist das auch der Augenblick wo der Tod augenfällig wird, weil alle Farbe aus dem Gesicht weicht. Der Mensch wird leichenblaß und verändert sein äußeres Wesen. […] Für alle, die das Gesicht noch rosig gesehen haben, ist das ein schwer erträglicher Moment. Bei Ekaterina Petrowna ist es genau anders herum. Es scheint als gewinne sie ihr Eigentliches zurück, als sei sie wieder das ernste, schöne Kind, das sie einmal gewesen ist und nicht das alberne, aufdringliche Wesen, das die Sehnsucht aus ihr gemacht hat.“[56]
Dieser verächtliche, medizinische Blick auf Menschen ist aus der Kolonialmedizin, der Rassenhygiene, Eugenik, Rassenanthropologie vor und während des Nationalsozialismus hinreichend bekannt und analysiert worden. Der Blick auf „die da“ offenbart das Aggressionspotenzial, das die Prozedur einer Organgewinnung in sich birgt. Die in der Hirntodliteratur wie auch in Interviews verwendeten Kennzeichnungen von Patienten mit Hirnversagen als „Herz-Lungen-Pakete“, „auf Fremdreize reagierende „Muskelmasse“[57] oder der in den USA gebräuchliche Begriff „human vegetable“[58] aus der eugenischen Lebenswertdebatte bringen das aggressive transplantationsmedizinische Beziehungsgeflecht sprachlich zum Ausdruck, wie einst auch der Ordinarius für Psychiatrie Alfred Hoche (1865 – 1943) und der Rechtswissenschaftler Karl Binding, als sie in ihrer Schrift von 1920 „Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens. Ihr Maß und ihre Form“ ein Konzept für die medizinische Tötung bestimmter Patienten mit Zuschreibungen wie „geistige Tote“ oder „leere Menschenhülsen“[59] zu legitimieren suchten.
Zwar unter einer gänzlich anderen Zielsetzung – der Rettung anderer Patienten – finden sich aber auch in der aktuellen Debatte um die Vergrößerung des Organspenderreservoirs Konzepte, in denen die Forderung offensiv vertreten wird, das Tötungstabu gänzlich aufzugeben. Nur ziehen die Autoren keineswegs ein eugenisches Kategoriensystem heran, sondern sie berufen sich auf Prinzipien der Patientenautonomie und Selbstbestimmung, die nunmehr im Rahmen der medizinischen Sterbehilfe zu realisieren seien. So fordern die britischen Bioethiker Dominic Wilkinson und Julian Savulescu (Oxford University) die Einführung der „Organspende-Euthanasie“[60], um jährlich tausenden von Menschen das Leben retten zu können. Statt dass „die Mehrzahl dieser Organe verrottet“[61], so die Autoren, wäre eine reiche Organressourcenquelle von Menschen mit einer aussichtslosen Erkrankung durch die Euthanasie im Rahmen eines selbstbestimmten Sterbens zu erschließen. Mit diesem Vorschlag wollen sie die Patientenautonomie durch die aktive Sterbehilfe stärken, den chronischen Organmangel beheben und die Qualität der Organe verbessern. So biete die transplantationsmedizinische Tötungsart weitaus frischere Organe im Vergleich zur jetzigen Organgewinnung von bereits im Sterben begriffenen Patienten mit Hirnversagen (‚Hirntod‘).
Wilkinson und Savulescu verstehen ihre ethische Rechtfertigung der Organbeschaffung als Ergänzung der Ausführungen von dem Bioethiker Robert D. Truog (Harvard Center for Bioethics) und Franklin G. Miller (National Institutes of Health). Seit 2008 erklären sie, die Hirntoddefinition sei biologisch nicht aufrecht zu erhalten. [62] Ihre Conclusio lautet: „Hirntote sind nicht wirklich tot“.[63] Aus dieser Neubewertung der transplantationsmedizinischen Entnahmepraxis leiten sie ein medizinisches Tötungsrecht ab und sprechen von einem „justified killing“,[64] einem gerechtfertigten Töten, um das Leben anderer Patienten retten zu können.
Mit dieser Legitimation des medizinischen Tötens beziehen sich die Autoren auf eine neuere Form der Organgewinnung, die in Eurotransplant-Verbundländern wie Belgien oder den Niederlanden erlaubt, in Deutschland oder Finnland hingegen noch als Tötung verboten ist: die Explantation von sogenannten ‚Spendern ohne schlagende Herzen‘ (Non Heart Beating Donors). So verwarf beispielsweise auch die deutsche Zentrale Ethikkommission bei der Bundesärztekammer die Organentnahme von Non Heart Beating Donors explizit als Tötung, denn bei diesen Patienten liegt noch kein Hirnversagen vor.[65] Und schließlich ist nach einem Herzstillstand der Mensch bis zu maximal 15 bis 20 Minuten aufgrund des weiterhin aktiven Hirnkreislaufs reanimierbar und kann ins Leben zurückgeholt werden. Bei Non Heart Beating Donors erfolgt die Organgewinnung genau in dieser Phase, also zu einem Zeitpunkt, an dem die ursprünglichen Kriterien des ‚Hirntodes‘ nicht erfüllt sind.
Magische Vorstellungen über das Weiterleben der Seelen von Organspendern im Körper ihrer Empfänger
Wie von Savulesku und Wilkinson vertreten, kommt dem Körper von Organspendern die Rolle von wiederverwertbarem Müll zu. Diese Funktionszuweisung entspricht dem in den USA gebräuchlichen Reklameslogan für Organspende: „Recycle yourself“[66]. Auch in Deutschland lautet die Legende eines Werbeplakats mit einem darauf abgebildeten Sarg: „Organe müssen leider draußen bleiben!“[67] Jedwede Sinnhaftigkeit unserer Sterbe- und Bestattungssitten wird durch eine solche Aufforderung zur therapeutischen Wiederverwertung bestimmter Patienten vollends verleugnet.
Aber entgegen solchen Zweckrationalisierungen unserer kulturellen Beziehung zu sterbenden und toten Menschen aktiviert die Transplantationsmedizin magische Phantasien, so dass selbst die Werbung des gerade zitierten Appells „Organe müssen leider draußen bleiben“ mit einer Parole überschriftet ist, die eine Weiterexistenz durch Organspende verspricht: „Träumst du von Unsterblichkeit, dann lass einen Teil von Dir weiterleben.“[68] Die damit aufgebaute Vorstellung von einem Weiterleben nach dem Tod entspringt wiederum der oben dargestellten animistisch-magischen Vorstellungswelt.
Schließlich beruht die Transplantationsmedizin darauf, Körperteile von anderen Patienten einzuverleiben. Diese Therapieform löst bei Organempfängern, ebenso wie bei deren Angehörigen häufig eine magisch begründete Angst vor den Seelenkräften der Organspender aus. Die Transplantation belebt folglich die magische Vorstellung von einer Seelenübertragung. Für diese speziellen psychischen Konflikte hat sich seit den 1980er Jahren die Organtransplantationspsychiatrie professionalisiert.
Auch sorgte der Dokumentarfilm „The Heart of Jenin“ (2008) von Marcus Vetter und Leon Geller für weltweite Schlagzeilen. Der Film berichtet über den Palästinenser Ismael Khatib, dessen Kind mit zwölf Jahren starb. Dieser Vater gab seinen Sohn zur Organspende für israelische Kinder frei und besuchte zwei Jahre später drei von jenen sechs Kindern, die Organe seines Sohnes transplantiert bekommen hatten – ein Kind hatte die Transplantation nicht überlebt.[69] Die Journalistin Inge Günther schreibt über die im Film gezeigten Begegnungsszenen: „Ismael Khatib sieht in allen drei Kindern etwas von Achmed, nicht nur die Organe. Er fühlt sich seinem toten Sohn näher, wenn er ihnen nah ist.“[70]
Obwohl das transplantationsmedizinische mechanistische Menschenbild, wonach Tote wie bei der Reparatur einer Maschine in brauchbare Einzelteile zerlegbar und wiederverwertbar werden, dem magischen Denken genau entgegengesetzt ist, können Organempfänger von der Idee beherrscht werden, dass in ihnen eine fremde Spenderseele mit einer unheimlichen Wirkmacht weiterlebt. Nicht zuletzt hat jeder transplantierte Mensch, wie ein auf einer Transplantations-Station tätiger Psychotherapeut erklärt, mit dem „Fremden im Eigenen“[71] fertig zu werden. Wenn dies nicht gelingt, kann sich die Furcht vor diesem „Fremden im Eigenen“ auf Horrorvorstellungen zuspitzen, in denen die Angst vor einer Rache der Toten zum Ausdruck kommt.
Gefühle der Besessenheit und Doppelgängerfantasien „treten“, wie der Sozialpsychologe Oliver Decker seine Forschungen resümiert, „in mehr oder weniger starker Ausprägung bei einem Großteil der Patienten auf, und das bereits vor der eigentlichen Transplantation, soviel kann nach den bisherigen Forschungsergebnissen als gesichert gelten“[72]. Dieses aus der Transplantationstherapie hervorgegangene Phänomen resultiert aus einer Verschmelzung von verpflanzungstechnischer Zweckrationalität mit der magischen Vorstellung über das Weiterleben einer im Organ schlummernden unbekannten Seele. Durch die transplantationsmedizinische Einverleibung des Organs eines ‚fremden Toten‘ ist jene durch Bestattungsbräuche symbolisch aufgebaute Grenze zwischen der ‚Welt der Toten‘ und der ‚Welt der Lebenden‘ aufgebrochen, so dass Rationalität und Magie sich auf eine eigenartige Weise zu mischen scheinen.
Dieser Text ist ein Ausschnitt aus dem in diesem Jahr erscheinenden Buch: „Das tödliche Dilemma. Organtransplantation zwischen ethischer Pflicht, Patientenautonomie und palliativer Sorge“
- Macho, Thomas: Todesmetaphern. Zur Logik der Grenzerfahrung. Frankfurt/M. 1987, S. 172. ↑
- Vgl. Fischer, Norbert: Neue Bestattungskultur. Tod, Trauer und Friedhof im Wandel. O. J. 2013. ↑
- Vgl. dazu Redlin, Jane: Säkulare Totenrituale. Totenehrung, Staatsbegräbnis und private Bestattung in der DDR. Münster et al. 2009, S. 111 ff. ↑
- Vgl. Heinen, Armin: Vom Nutzen und Nachteil der „dienstbaren Leiche“ für die Toten und die Lebenden. Ein Ideenskelett. In: Groß, Dominik/Grande, Jasmin (Hg.): Objekt Leiche. Technisierung, Ökonomisierung und Inszenierung toter Körper. Frankfurt am Main 2010, S. 429 – 451, hier S. 430. ↑
- Vgl. Bergmann, Anna. Der entseelte Patient. Die moderne Medizin und der Tod. (2. Aufl. TB) Stuttgart 2019, S. 91 – 203. ↑
- Macho, Thomas: Tod. In: Vom Menschen. Handbuch Historische Anthropologie. Hrsg. von Christoph Wulf, Weinheim/Basel 1997, Macho 1997, S. 939 – 954, hier 940. ↑
- Vgl. ebd., S. 939 – 954. ↑
- Archiv Anna Bergmann (AAB), Interview Thomas von Hehl vom 29.04.2019. ↑
- Vgl. z.B. Hirsch, Günter/Schmidt-Didczuhn, Andrea: Transplantation und Sektion. Heidelberg 1992; Stellpflug, Martin H.: Der strafrechtliche Schutz des menschlichen Leichnams. Eine rechtsvergleichende Studie zur strafrechtlichen Beurteilung von Handlungen am menschlichen Leichnam in der Bundesrepublik Deutschland, Großbritannien und der Republik Österreich. Frankfurt am Main et al. 1996; Tag, Brigitte/Groß, Dominik (Hg.): Der Umgang mit der Leiche. Sektion und toter Körper in internationaler und interdisziplinärer Perspektive. Frankfurt/M. 2010. ↑
- Stelkens, Ulrich/Cohrs, Beate: Bestattungspflicht und Bestattungskostenpflicht. In: Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 21 (2002), H. 8, S. 917 – 925, hier S. 922. ↑
- Vgl. Hirsch/Schmidt-Didczuhn 1996, S. 34 – 66, 122 – 135; Schreiber, Hans-Ludwig: Rechtliche Aspekte der Organtransplantation. In: Beckmann, Jan P./Kirste, Günter/Schreiber, Hans-Ludwig: Organtransplantation. Medizinische, rechtliche und ethische Aspekte. Freiburg/München 2008, S. 64 – 92, hier 65. ↑
- Vgl. zu den Transplantationsgesetzgebungen in dieser Aufbauphase des Transplantationssystems in West- und Nordeuropa: Wolfslast, Gabriele: Transplantationsrecht im europäischen Vergleich. In: Zeitschrift für Transplantationsmedizin 1(1989), S. 43 – 48. ↑
- Vgl. z.B. Ebbinghaus, Uwe: Erschreckend einfach. Vom 16. Lebensjahr an dürfen Jugendliche einen rechtlich bindenden Organspendeausweis unterschreiben. Eltern haben keinen Einfluss darauf. Diese Praxis ist voller Widersprüche. In: FAZ vom 26. Februar 2020, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/organspende-bei-jugendlichen-erschreckend-einfach-16651338.html (4.03.2021). ↑
- Vgl. Fröhlich, Anne: Die Kommerzialisierung von menschlichem Gewebe: Eine Untersuchung des Gewebegesetzes und der verfassungs- und europarechtlichen Rahmenbedingungen. Hamburg 2012, S. 53 – 57.↑
- Vgl. Jonas, Hans: Technik, Medizin und Ethik. Zur Praxis des Prinzips Verantwortung. Frankfurt/M. 1987, S. 222, Anm. 6, S. 240. ↑
- Vgl. z.B. für Deutschland: Höfling, Wolfram: Irreversibler Hirnfunktionsausfall während der Schwangerschaft. In: Medizinrecht (2020), H. 38, S. 14 – 16. Onlinepublikation: https://doi.org/10.1007/s00350-019‑5424‑3 ↑
- Vgl. Freud, Sigmund (1912/13): Totem und Tabu. In: Studienausgabe. Hrsg. von Alexander Mitscherlich, Angela Richards, James Strachey. Bd. 9. Frankfurt/M. 2000, S. 287 – 444, hier, S. 311. ↑
- Vgl. Depenheuer, Otto: Recht und Tabu – ein Problemaufriß. In: Ders. (Hg.): Recht und Tabu. Wiesbaden 2003, S. 7 – 23, hier S. 20. ↑
- Depenheuer 2003, S. 11. ↑
- Mitscherlich, Alexander (1963): Auf dem Weg zur vaterlosen Gesellschaft. Ideen zur Sozialpsychologie. München 1973 (Neuausgabe), S. 256. ↑
- Vgl. dazu und auch für das Folgende: Bergmann, Anna: Töten, Opfern, Zergliedern und Reinigen in der Geschichte des modernen Körpermodells. In: metis 11 (1997), S. 45 – 64; Dies. 2019, S. 110 – 202; Stukenbrock, Karin: „Der zerstückte Cörper”. Zur Sozialgeschichte der anatomischen Sektionen in der frühen Neuzeit (1650 – 1800). Stuttgart 2001; Park, Katharine: Secrets of Women: Gender, Generation, and the Origins of Human Dissection. New York 2006. ↑
- Vgl. auch für das Folgende: Wolf-Heidegger, Gerhard/Cetto, Anna Maria: Die anatomische Sektion in bildlicher Darstellung. Basel – New York 1967, S. 64 – 71; Ferrari, Giovanna: Public Anatomy Lessons and the Carnival: The Anatomy Theatre of Bologna. In: Past & Present 117 (1987), S. 50 – 106; Bergmann, Anna: Massensterben und Todesangst im 17. Jahrhundert: Zur rituellen Leichenzergliederung im Anatomischen Theater. In: Theatralität und die Krise der Repräsentation. DFG-Symposion, hrsg. v. Erika Fischer-Lichte, Stuttgart – Weimar 2001, S. 316 – 336; Dies., Der entseelte Patient. Die moderne Medizin und der Tod 2004, S. 175 – 198. ↑
- Vgl. Wolf-Heidegger 1967, S. 82. ↑
- Vgl. auch für das Folgende: Linkert, Christine: 75 Träume von Medizinstudenten während des Präparierkurses: eine psychoanalytisch orientierte empirische, qualitative Untersuchung. Med. Diss. Frankfurt am Main 1989; Dies.: Die Initiation der Medizinstudenten. In: Ethnopsychoanalyse 3 (1993), S. 135 – 143; Schneider, Gisela: Der Medizinstudent m Seziersaal. In: Lockot, Regine/Rosemeier, Hans Peter (Hg.): Ärztliches Handeln und Intimität. Stuttgart 1983, S. 202 – 222; Richardson, Ruth: Death, Dissection an the Destitute. London 2000 (2. Aufl.), S. 30 – 50. ↑
- Mitscherlich 1973, S. 256. ↑
- Chen, Pauline W.: Der Tod ist nicht vergessen. In der Kälte des Medizinbetriebs – eine junge Ärztin findet ihren Weg. Aus dem Amerikanischen von Christina Kotte und Andrea Schleipen. Freiburg/Basel/Wien 2007, S. 23. ↑
- Wrusch 2018. ↑
- Vgl. Chen 2007, S. 23; Wrusch, Paul: Maries Leiche. In: TAZ vom 03.11.2018, https://taz.de/Praepkurs-im-Medizinstudium/!5543447/ (04.03.2021); Wu, Jing: Meine erste Leiche. In: Spiegel.de vom 17.10.2016, https://www.spiegel.de/lebenundlernen/uni/medizinstudium-erfahrungen-im-praeparierkurs-a-1114532.html (04.04.2021); Ottersbach, Myriam: Meine Erfahrungen im Präpkurs. In: Elsevier vom 11.12.2015, https://www.elsevier.com/de-de/connect/anatomie/meine-erfahrungen-im-prapkurs (04.03.2021). ↑
- Rothman Ellen L.: White Coat: Becoming a Doctor at Harvard Medical School. New York 2000, S. 21: „I didn’t want to know any more than I did. It would be too painful to dissect structure by structure with the burden of personhood and the relationship and responsibilities it entailed.“ ↑
- Wrusch 2018. ↑
- Richardson 2000, S. 30: „The study of anatomy by dissection requires in its practitioners the effective suspension of suppression of many normal physical and emotional responses to the wieful mutilation of the body of another human being. “ ↑
- Wrusch 2018. ↑
- Freud 2000, S. 313. ↑
- Vgl. Feuerstein, Günther: Das Transplantationssystem. Dynamik, Konflikte und ethisch-moralische Grenzgänge. Weinheim/München 1995, S. 121 – 178. ↑
- Vgl. z.B. Deutsche Stiftung Organtransplantation: Leitfaden für die Organspende. Frankfurt am Main 2003 (2. überarb. Aufl.) Kapitel 7, S. 9; Swisstransplant. Nationaler Ausschuss für Organspende: Modul IV. Organ- und Gewebeentnahme. O. O. 2014, Modul VI, S. 9. ↑
- Zit.n. Baureithel, Ulrike/Bergmann, Anna: Herzloser Tod. Das Dilemma der Organspende. Stuttgart 1999, S. 177. ↑
- AAB, Interview Dr. Marek Brodezky vom 08. April 2015. ↑
- Zit.n. Baureithel/Bergmann 1999, S. 158. ↑
- Zit.n. ebd., S. 163. ↑
- Zit.n. ebd., S. 163 f. ↑
- Zit.n. ebd., S. 165. ↑
- Zit.n. ebd., S. 166. ↑
- Vgl. Baureithel/Bergmann 1999; Lindemann: Beunruhigende Sicherheiten. Zur Genese des Hirntodkonzepts. Konstanz 2003. ↑
- Macho 1997, S. 941. ↑
- Macho 1987, S. 180. ↑
- AAB, Interview Dr. Marek Brodezky vom 08. April 2015. ↑
- Vgl. Pendl, Gerhard: Der Hirntod. Eine Einführung in seine Diagnostik und Problematik. Wien/New York 1986, S. 30 ff. ↑
- So eine Anästhesistin im Interview, zit. n. Baureithel/Bergmann 1999, S. 152. ↑
- Vgl. Schwarz, Gerhard: Dissoziierter Hirntod. Berlin et. al. 1990, S. 44 – 45. ↑
- Feuerstein 1995, S. 229. ↑
- Zit.n. Witt, Maxi von: Transplant. Hamburg 2012, S. 100. ↑
- Zit. n. Baureithel/Bergmann 1999, S. 171. ↑
- Deutschland ist an die 1967 gegründete Privatstiftung Eurotransplant assoziiert. Sie organisiert länderübergreifend die Gewinnung und Verteilung von Organen in acht europäischen Ländern: Belgien, Deutschland, Kroatien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Slowenien, Ungarn. ↑
- Zit. n. Baureithel/Bergmann 1999, S. 65. ↑
- Zit.n. Bergmann 2019, S. 258. ↑
- Berning, Peter: Augen sind Flüsse. In: Sorg, Petra/Brüns, Henning (Hg.): Sehnsucht Berlin. Frankfurt 2000. S. 254 – 258, hier 254, 255f., 257, 258. (Hervorhebung Anna Bergmann) ↑
- Prof. Dr. Jürgen Link im Deutschen Bundestag: „Beim Hirntoten kommt aber nichts mehr aus dem ohnehin nicht mehr existierenden Wesen, sondern die Muskelmasse reagiert auf Fremdreize.“ In: Deutscher Bundestag. Ausschuss für Gesundheit, 13. Wahlperiode, Protokoll Nr. 64, Sitzung vom 25.9.1996, S. 1661. ↑
- Zit.n. Jonas 1987, S. 228. ↑
- Binding, Karl/Hoche, Alfred: Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens. Ihr Maß und ihre Form. Leipzig 1920, S. 55. ↑
- Wilkinson, Dominic/Savulescu, Julian:Should we allow Organ Donation Euthanasia? Alternatives for Maximizing the Number and Quality of Organs for Transplantation. In: Bioethics 26 (2012), H. 1, S. 32 – 48. ↑
- Wilkinson/Savulescu 2010, S. 32: „Thousands of patients every year die on the waiting lists for transplantation. Yet there is one currently available, underutilized, potential source of organs. Many patients die in intensive care following withdrawal of life-sustaining treatment whose organs could be used to save the lives of others. At present the majority of these organs go to waste.“ ↑
- Vgl. Truog, Robert D./Miller, Franklin G: The Dead Donoar Rule and Organ Transplantation. In: The New England Journal of Medicine 359 (2008), H. 7, S. 669 – 675. ↑
- Truog, Robert D./Miller, Franklin G.: Rethinking the Ethics of Vital Organ Donations. In: Hastings Report 38 (2008) 6, S. 41: „How can it be ethical to retrieve vital organs from brain dead patients if they are not really dead? Since 1968, brain death has been understood as legitimating the withdrawal of life support and the extraction of vital organs. Both of these remain ethically appropriate when brain dead patients are understood to be still alive but in a state of irreversible coma.“ In: https://philpapers.org/rec/MILRTE. ↑
- Ebd., S. 42. ↑
- Vgl. Erklärung der Zentralen Ethikkommission bei der Bundesärztekammer: Tötung durch Organentnahme widerspricht ärztlicher Ethik. Abgedr. in: Deutsches Ärzteblatt 94 (1997), H. 28/29, S. A1963; vgl. auch Heide, W.: „Non-heart-beating donors“ sind nicht geeignet. In: Nervenarzt 87 (2016), S. 161 – 168. ↑
- https://www.amazon.com/shopdoz-Stickers-Recycle-Yourself-Awareness/dp/B07XDZS6BS ↑
- Deutsche Stiftung Organtransplantation. Neu-Isenburg o. J., S. 13. ↑
- Ebd. ↑
- Vgl. Das Herz von Jenin: http://www.textezumfilm.de/sub_detail.php?id=732 (04.03.2021) ↑
- Günther, Inge: Ein Herz aus Dschenin. Ismael Khatib hat seinen Sohn verloren und entschieden, dass israelische Kinder mit dessen Organen gerettet werden sollen. In: Badische Zeitung vom 13. August 2008. https://www.badische-zeitung.de/ein-herz-aus-dschenin – 4208012.html (04.03.2021) ↑
- Zit. n. Baureithel/Bergmann 1999, S. 198. ↑
- Decker, Oliver: Der Prothesengott. Subjektivität und Transplantationsmedizin. Gießen 2004, S. 116 f.Die Medizin- und Kulturhistorikerin Anna Bergmann ist als apl. Professorin für Kulturgeschichte an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) tätig und lehrte als Gastprofessorin an den Universitäten in Braunschweig, Graz, Innsbruck, Klagenfurt und Wien. Buchpublikationen u.a.: zusammen mit Ulrike Baureithel: Herzloser Tod. Das Dilemma der Organspende, Stuttgart 1999 (2. Aufl. 2001) – ausgezeichnet von „bild der wissenschaft“ als „Wissenschaftsbuch des Jahres 2000“; Der entseelte Patient. Die moderne Medizin und der Tod. Berlin 2004 (2. Auflage Stuttgart 2015; Taschenbuch Stuttgart 2019). ↑