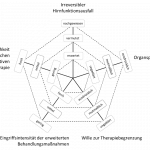Mitte der 1990er-Jahre habe ich an vielen Organentnahmen als Anästhesist mitgewirkt. Den damals wie heute üblichen Vorgaben entsprechend wurden bei der Organentnahme keine Narkotika verwendet. Die Organspender waren – ja sollten – tot sein. Jeder, der bei Organentnahmen (Explantationen) dabei war, weiß, dass Patienten sich bei Beginn der Operation noch bewegen und ihr Blutdruck sowie ihre Herzfrequenz als Reaktion auf die Eröffnung des Körpers ansteigen können. Freilich sind dies alles, so wird erklärt, Reaktionen, die „nur“ vom Rückenmark ausgehen. Nun ja, das Rückenmark scheint noch zu leben und gehört zum zentralen Nervensystem. In dieser Situation kam vor vielen Jahren meine damalige Oberärztin in den OP-Saal und drehte den Narkosemittelverdampfer auf. Der Patient, dessen Organe gerade entnommen wurden, bekam also eine Anästhesie. Dies ist ein „kleines“ Eingeständnis dafür, dass der vielleicht doch noch nicht so ganz tot ist, wie gemeinhin behauptet wird. Sollte ich etwa eine Leiche narkotisieren? Ich fragte die Anästhesistin, was das denn nun sollte, schließlich wäre der Patient doch tot. Sie antwortete knapp: „Wissen Sie das so genau, Herr Stahnke?“ An diese Worte werde ich mich immer erinnern.
Ja, woher weiß ich das so genau? Das sollte sich jeder fragen. Und so begannen meine Zweifel. Als ich mich näher mit dem sogenannten „Hirntod“ beschäftigte und auch eine Veranstaltung besuchte, an der Kritiker und Befürworter des Hirntodkriteriums teilnahmen und bei der auch eine Schulklasse im Publikum war, wunderte ich mich, welche Vorstellungen über den Gesundheitszustand von Organspendern kursierten. Die Organspender wären an Herz-Lungen-Maschinen angeschlossen, hätten Herzschrittmacher und Ähnliches. Der Körper, das Fleisch, die Organe, so die Vorstellung, könnten nur mit maximaler Unterstützung der Intensivmedizin quasi konserviert werden. Dies ist, zumindest in der von den Schülern angenommenen Ausprägung, nicht der Fall.
Hirntote Patienten sind auf den ersten Blick gar nicht von anderen intensivmedizinisch betreuten Patienten zu unterscheiden. Sie sind warm, produzieren Urin, erhalten Medikamente, werden ernährt und gepflegt so wie alle anderen beatmeten Patienten auch. Kein Herzschrittmacher, keine Herz-Lungen-Maschine. Und selbst die Atmung kann bei diesen Patienten besser sein als bei so manch anderen schwer kranken Intensivpatienten. Das muss ja auch so sein, von wem sollten die zu transplantierenden Lungen sonst stammen? Nur funktioniert definitionsgemäß das Auf und Ab des Brustkorbes nicht, der Sauerstofftransport hingegen ist tadellos intakt. Die zur Organspende vorgesehenen Menschen weisen für jeden Menschen sichtbar eindeutige Zeichen des Lebens auf. Diese Patienten sind allerdings schwerkrank und würden ohne die intensivmedizinische Behandlung tatsächlich sterben, bis sie sich in eine Leiche verwandeln und kalt, starr und blassblau sind. All das sind Hirntote nicht.
Zum Begriff des Hirntodkriteriums
In der Diskussion über die Hirntod-vereinbarung werden allgemein drei Ebenen unterschieden.[1]: Erstens die Frage nach dem Todesbegriff oder nach dem Todesverständnis: Wie ist der Status „tot“ zu fassen? Daran schließt sich die Bestimmung des Todeskriteriums an: Wann ist jemand tot? Die Antwort darauf wird durch diagnostische Tests, die für eine Todesuntersuchung notwendig sind, gegeben, und an die Frage geknüpft sind: Wie ist der Zeitpunkt des Todeseintritts feststellbar? Diese drei Ebenen werden in der Diskussion über den Hirntod häufig verwischt.
Der Hirntod als Kriterium – also: das Hirntodkriterium – erfüllt eben nicht die Ansprüche für eine Definition des Todes. Es ist ein Symptom. Und dieses Anzeichen muss für die von uns gewählte Todesdefinition akzeptabel sein. Die als sicher bezeichneten Todeszeichen wie Leichenflecken und Totenstarre sind Kriterien der seit Jahrhunderten und der bis heute bestehenden Ansicht: Der Stillstand des Herzens und das anschließend folgende Versagen aller Organe, nicht nur eines einzelnen Organs, zeigen den Tod an.
In Diskussionen, insbesondere mit Ärzten, werde ich immer wieder gefragt, wie ich nur solch eine „unwissenschaftliche“ Haltung gegenüber dem Hirntod als Tod des Menschen einnehmen könne. Die Antwort ist simpel: Es gibt keine „wissenschaftliche“ Haltung, gegen die ich verstoße.
Die bekannte Empfehlung des Ad Hoc Committee der Harvard Medical School von 1968[2], ein Meilenstein in der Verpflanzungschirurgie, wie Transplantationsmediziner sagen und auf die sie sich immer wieder berufen, hat nichts anderes gemacht, als das unumkehrbare Koma zu dem Kriterium für den eingetretenen Tod festzulegen. Sie erinnern sich, wir befinden uns auf der Ebene der Kriterien. Mit der Aufstellung eines einzigen Merkmals werden wir jedoch noch lange nicht den Ansprüchen für eine Definition des Todes gerecht. Ein Kriterium muss mit einer Definition des Todes korrespondieren können, damit es als Merkmal gelten kann. Die Harvard-Kommission hat hingegen keine neue Definition des Todes vorgelegt. Sie hat die kriteriologische Ebene mit der definitorischen vermischt und in eins gesetzt. Entsprechend lautet auch die Überschrift des Reports: „A Definition of Irreversible Coma“. Und daraus wurde unreflektiert geschlossen: Die neuen Todesdefinition. In erstaunlicher Schlichtheit ist dort zu lesen:
”Our primary purpose is to define irreversible coma as a new criterion for death.” Also: „Unser primäres Anliegen ist, das irreversible Koma als neues Todeskriterium zu definieren.“
In der Einleitung heißt es: „2. Überholte Kriterien für die Definition des Todes können zu Kontroversen bei der Beschaffung von Organen zur Transplantation führen.“ Es ist kaum zu glauben: Unverhohlen wird hier ein neues Todeskriterium eingeführt und unreflektiert als Todesdefinition gedeutet, um Organe für Transplantationen zu gewinnen. So schreibt der Medizinhistoriker Thomas Schlich in seinem Aufsatz „Ethik und Geschichte: Die Hirntoddebatte als Streit um die Vergangenheit“[3]: „Eine weitergehende inhaltliche Begründung, warum das neue Kriterium tatsächlich den Tod des Menschen anzeige, gab die Kommission nicht.“
Auch erklärt Claudia Wiesemann[4]: „Die zurzeit gültigen Kriterien für den Ausfall ‚aller‘ integrativen Leistungen des Organismus stellen ebenso wie die festgesetzten Symptome für das Absterben des Hirnstammes nur eine Auswahl dar.“ Diese werden übrigens in verschiedenen Ländern mit jeweils unterschiedlichen Parametern getroffen. Wiesemann führt weiter aus, oft werde verschleiert, „dass überhaupt von Menschen aufgrund bestimmter Argumente signifikante von nicht signifikanten Zellmengen unterschieden werden. Die zerstörten Hirnzellen selbst, rufen den Hirntod hervor‘. Hinter dieser Formulierung verschwindet der Wissenschaftler oder die Gesellschaft.
Hier wird suggeriert, die Schwelle zum Hirntod sei ein in der Natur vorgegebenes Phänomen.
Doch dieser Übergang vom Tod einzelner Zellen zum Hirntod ist nicht schon natürlich vorhanden und wird deswegen auch nicht von der Natur in einem bestimmten Moment überschritten. Er wird von Menschen gesetzt.“ Die vielen unterschiedlichen Parameter sind schließlich eine Konsequenz dieser von Menschen gemachten Todesdefinition. Ein Beispiel – Sie erinnern sich an die muskelentspannenden Mittel oder die Narkose, die auch ich als Anästhesist Hirntoten schon wegen ihrer Reaktionsfähigkeiten, die im Rückenmark angesiedelt werden, verabreicht habe: Die Harvard-Kommission legte das Ausbleiben aller Reflexe sowie Muskelbewegungen als zwei von insgesamt vier Symptomen des Hirntods („No Movements“, „no reflexes.“)[5] fest, weil sie das Rückenmark morphologisch noch zum Teil des Gehirns zählte. Das Ausbleiben aller Reflexe wurde allerdings noch im selben Jahr 1968 aufgegeben, weil die „Harvard-Hirntoten“ für die Bedürfnisse der Transplantationsmedizin bereits zu tot waren.[6]
Und noch etwas zur Historie der Transplantationsmedizin
1967 gab es in Südafrika einen drahtigen, ehrgeizigen Chirurgen namens Christiaan Barnard. Das folgende Zitat stammt aus einer Festschrift des Universitätsspitals Zürich zum dortigen 50-jährigen Jubiläum der Herzchirurgie.[7] Darin lesen wir:
„Am 3. Dezember 1967 hat Christiaan Barnard am Groote Schur Hospital in Kapstadt in Südafrika die erste Herztransplantation bei einem Menschen durchgeführt. Vorausgegangen war ein Wettlauf zwischen Barnard und mehreren Herzchirurgen in den USA. Hierzu gehörten Norman Shumway an der Stanford University, Richard Lower in Virgina und Adrian Kantrowitz in New York. Barnard siegte.“ Unter der Zwischenüberschrift „Die Früchte der anderen ernten“ heißt es weiter:
„Shumway und Lower hatten bereits im Jahre 1958 in Stanford begonnen, Tierexperimente auf dem Gebiet der Herztransplantation durchzuführen. Sie entwickelten Methoden zur chirurgischen Technik der Herztransplantation sowie zur Präservation des Herzens. Ende 1959 gelang ihnen die erste erfolgreiche Herztransplantation an einem Hund. Ein bedeutendes Ereignis, erschien es gar auf der Titelseite der New York Times vom 31. Dezember 1959. Auch wenn das Stanford-Team rein technisch der Durchführung der ersten menschlichen Herztransplantation am nächsten kam, waren es doch die ungelösten Probleme der Abstoßungsreaktion, die sie bremsten. Außerdem gab es Bedenken dazu, wann beim Menschen ein Herz explantiert werden konnte. Die Definition des Hirntods gab es zu dieser Zeit noch nicht. 1966 kam Christiaan Barnard nach Virginia, um sich zum Problem der Abstoßung weiterzubilden. Sein Ziel war es, in Südafrika Nierentransplantationen durchzuführen. In den Monaten der Jahre 1966 und 1967 waren Richard Lower in Virgina und Norman Shumway in Stanford bereit für die erste Herztransplantation. Doch die Suche nach einem passenden Spender war zunächst nicht erfolgreich. Adrian Kantrowitz in New York scheiterte am Widerstand seines Teams und an der noch fehlenden Akzeptanz des Hirntods. So konnte schließlich Christiaan Barnard seinen amerikanischen Kollegen in seinem Heimatland zuvorkommen. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die in Südafrika nicht so strikt waren wie in den Vereinigten Staaten, haben Barnard diesen Vorteil verschafft. Er konnte das Herz einem hirntoten Spender entnehmen, was in den USA zu diesem Zeitpunkt noch nicht erlaubt war.“
Und Mitte 1968, ein paar Monate nach dem für die amerikanischen Mediziner schmählich verlorenen Wettlauf um die erste Herztransplantation, hatte das Harvard-Ad-Hoc-Committee sein Gutachten vorgelegt, in dem auch das Motiv dieser Expertise erklärt ist: Man wollte die Kontroversen für die Organbeschaffung der internationalen Transplantationsmedizin beilegen. Und diese, wie es bei Hans Jonas heißt, „pragmatische Umdefinierung des Todes“[8] soll nichts mit dem damaligen Stand der Transplantationsmedizin zu tun gehabt haben?
Eine Grenze zwischen Leben und Tod existiert nicht. Sie wurde aber gezogen, um die Organentnahme bei Menschen mit einem Hirnversagen zu ermöglichen.
Ohne diese hypothetische und durch keine medizinisch-naturwissenschaftliche Methode empirisch beweisbare Todesdefinition im Sinne eines Naturgesetzes wäre die Weiterentwicklung der Transplantationsmedizin nicht möglich gewesen.
Jetzt erklärt sich auch die Wahl meines Titels.
Der sogenannte „Hirntod“ ist keine Definition, kein morphologischer Zustand, sondern allenfalls ein Hirntodsyndrom. Denn ein Syndrom kennzeichnet allein eine Anzahl von der Medizin selbst aufgestellter Symptome, um daraus eine Krankheitsbezeichnung abzuleiten und zu bestimmen.[9] Selbstverständlich wurden in der Geschichte der Medizin diagnostische Kritierien für Krankheitsbilder immer wieder aufgegeben, revidiert und neu bestimmt, wie dies auch in der Genese des Hirntodsyndroms der Fall war und ist.
„In dem Formular zur Beantragung des Organspendeausweises wird jedem Bürger der jetzige Entscheidungsweg belassen, jedoch um eine weitere Wahlmöglichkeit ergänzt – etwa mit folgenden Worten: Weil ich das Hirntodkonzept für falsch, unmenschlich, verfassungswidrig oder unmoralisch halte, bin ich zur Spende meiner Organe zwar bereit, aber nur unter der Bedingung, dass alle Beteiligten davon ausgehen, dass ich nicht nur bis zu meinem sogenannten Hirntod, der real nur als Hirntodsyndrom existiert, sondern bis zu meinem Herztod ein lebender Mensch und nicht aus der Gemeinschaft der Lebenden ausgeschlossen bin.“
Ich möchte anmerken, dass diese Formulierung „Ausschließen aus der Gemeinschaft“ mich stark berührt hat und aus meiner Sicht die gedrückte Atmosphäre bei einer Organentnahme sehr gut erfasst. Ich zitiere weiter: „Das bedeutet zwar für die Ärzte eine moralische Erschwerung, aber für mich genauso; denn ich kann eine Spende, ein Geschenk, ein Opfer, eine Gabe nicht als Leiche, sondern nur als lebender Mensch geben; nur als lebender Mensch kann ich mich von einem anderen dazu bestimmen lassen. Insofern kann es nur Lebendspenden geben. Und schließlich: Ob der Arzt mir nur eine Niere entnimmt oder ob er mit dem Abklemmen der Herzgefäße meinen ohnehin sich vollziehenden, oft sogar überfälligen Sterbeprozess gewähren lässt – in jedem Fall begeht er im herkömmlichen Sinne eine strafbare Körperverletzung, gerechtfertigt nur aufgrund meiner frei gewählten Verantwortung und auch nur dann, wenn ich mit meiner Verantwortung auf die vitale Not eines konkreten anderen antworte, mich einer Bedeutung für andere aussetze, was mich in der letzten Lebensphase eines Sterbens ohnehin mehr bestimmt als meine Selbstbestimmung. Mit diesem fairen Lastenausgleich zwischen allen wäre Vertrauen wiederhergestellt. Ärzte, Pflegende, Spender, Angehörige und Empfänger wären wieder ehrlich, die Spendenbereitschaft würde erheblich steigen. Und alle könnten mit diesem Kompromiss für die heutige Übergangszeit leben, bis der technische Fortschritt die trotz allem immer fragwürdige Organspende überflüssig gemacht haben wird.“[10]
Literatur
- ↑ Erk, Christian: Das Eigentliche des Todes. Ein Beitrag zur Belebung der Debatte über Hirntod und Transplantation. In: Ethik Med 26 (2014), S. 121 – 135.
- ↑ A Definition of Irreversible Coma. Report of the Ad Hoc Committee of the Harvard Medical School to Examine the Definition of Brain Death. In: Journal of the American Medical Association 205 (1968), H. 6, S. 337 – 340, hier S. 337. doi:10.1001/jama.1968.03140320031009.
- ↑ Schlich, Thomas: Ethik und Geschichte: Die Hirntoddebatte als Streit um die Vergangenheit. In: Ethik Med 11 (1999), S. 79 – 88
- ↑ Wiesemann, Claudia: Hirntod und Gesellschaft. In: Ethik Med 7 (1999), S. 16 – 28.
- ↑ A Definition of Irreversible Coma 1968: „No Movements or Breathing. – Observations covering a period of at least one hour by physicians is adequate to satisfy the criteria of no spontaneous muscular movements […].“ S. 337: „3. No reflexes. – Irreversible coma with abolition of central nervous system activity is evidenced in part by the absence of elicitable reflexes. […] As a rule the stretch of tendon reflexes cannot be elicited; ie, tapping the tendons of the biceps, triceps, and pronator muscles, quadriceps and gastrocnemius muscles with the reflex hammer elicits no contraction of the respective muscles. Plantar or noxious stimulation gives no response.“ S. 338.
- ↑ Vgl. Lindemann, Gesa: Beunruhigende Sicherheiten. Zur Genese des Hirntodkonzepts. Konstanz 2003, S.5. Bergmann, Anna: Der entseelte Patient. Die moderne Medizin und der Tod. Stuttgart 2019, S. 266f.
- ↑ Wilhelm, Markus: Herzwechsel. Dem Mythos Herztransplantation auf der Spur. In: 50 Jahre Herzchirurgie am Universitätsspital Zürich. Hrsg. von Volkmar Falk und Sacha Salzberg. o.J. Zürich S. 88 – 90.
- ↑ Jonas, Hans: Gehirntod und menschliche Organbank: Zur pragmatischen Umdefinierung des Todes. In: Ders.: Technik, Medizin und Ethik: Zur Praxis des Prinzips Verantwortung. Frankfurt am Main 1985, S. 219 – 241.
- ↑ PSYCHREMBEL. Klinisches Wörterbuch. Hrsg. von der Psychrembel-Redaktion. Berlin/New York 1994 (257. neu bearb. Aufl.)
- ↑ Dörner, Klaus: Vortragsmanuskript. Vortrag gehalten am 27.05.2005 in Hannover (Podiumsdiskussion auf dem 30. Evangelischen Kirchentag), S. 3 – 4.
Dieser Beitrag erschien auch in dem sehr lesenswerten Magazin
„Praxis PalliativeCare 44 / 2019 | Thema: Die ‚palliative‘ Seite der Organtransplantation„
Inhaltsverzeichnis (PDF, 129 kB)
Sie können dieses Heft direkt bestellen bei
https://www.praxis-palliativecare.de