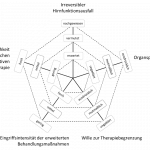Alle therapeutischen Maßnahmen zielen exklusiv auf die unter Zeitdruck stehende Gewinnung der Organe ab. Keine einzige medizinische Maßnahme erfolgt zum Wohl der Spender. Ab dem Zeitpunkt ihrer Todesfeststellung auf der Intensivstation haben sie als Tote alle Patientenrechte verloren. Jegliche Sorge um die Sterbenden wird zugunsten ihrer Verdinglichung hinfällig. Und so hat die Palliativmedizin während der intensivmedizinischen „Spenderkonditionierung“, ebenso wie bei dem auf dem Operationstisch erfolgenden chirurgisch erzeugten Herztod der Spender zu weichen.
Die Medizinierung des Todes
Die Sorge um sterbende Menschen und der Umgang mit den Toten sind in allen Kulturen von spirituellen sowie religiösen Bräuchen geprägt. Parallel zur Praxis unserer Sterbe- und Bestattungssitten ist die moderne Medizin für die kulturelle Wahrnehmung des Sterbens und des Todes federführend geworden. Der medizinisch-naturwissenschaftliche Zugang legt den Akzent auf die Beobachtung pathophysiologischer Vorgänge. Definitionen wie die des „klinischen Todes“ oder des „Hirntodes“ beschränken sich auf biologische Beschreibungen des Sterbens und des Todeseintritts, wobei der Verlust einzelner Organfunktionen im Zentrum steht. Diese auf physiologische Prozesse reduzierte Wahrnehmungsweise war bis zur Etablierung der Hospizbewegung und der Palliativmedizin Ende des 20. Jahrhunderts ganz allein handlungsanweisend für den Umgang mit Sterben und Tod im Krankenhaus.
Im Zuge der Medizinierung des Todes verlagerte sich das Sterben immer mehr in die Klinik. Damit wurde nicht nur ein Ortswechsel vollzogen. Vielmehr verbinden sich für Betroffene und deren Angehörige mit dem medizinischen, auf biologische Abläufe fokussierten Wahrnehmungsmuster des Todes im Krankenhaus gänzlich andere Erfahrungen als mit dem Sterben in der häuslichen Umgebung. Das Ende des Lebens eines an Monitore, Schläuche und Apparateangeschlossenen Menschen wird zunehmend als Gipfel einer inhumanen Medizin gefürchtet, sodass mittlerweile Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen dieses Horrorszenario zu verhindern suchen.
Heutzutage stirbt etwa ein Drittel der Bevölkerung in der eigenen Wohnung und zwei Drittel in Institutionen. Dem naturwissenschaftlich rationalisierten Zugang zum Tod auf der Intensivstation entspricht der von der Realität stark abweichende Wunsch vieler Menschen, in der vertrauten Umgebung zu sterben, wie die in einem Hospiz arbeitende Ärztin Dr. Elisabeth Medicus aus Innsbruck berichtet: „70 Prozent wollen zu Hause sterben und nur 30 Prozent lieber in einer Institution.“ Diesem Bedürfnis nach einem Sterben, das Ruhe und Raum für die gemeinschaftliche wie individuelle Bewältigung spiritueller Art lässt, kommen vor allem unsere traditionellen Bräuche der Sterbebegleitung und der Totenpflege entgegen.
Die Palliativmedizin und die Hospizbewegung haben eine Rückbesinnung auf die hohe kulturelle Bedeutung dieser Traditionen in Gang gesetzt. Sie konzentrieren sich auf die sozialen wie physischen Bedürfnisse der Sterbenden und respektieren vor allem die Grenzen der ärztlichen Kunst zu heilen. Schon der berühmte Arzt des Altertums Hippokrates untersagte geradezu, unheilbare Menschen zu behandeln. Das Sterben wurde nicht als eine medizinisch zu bekämpfende Krankheit aufgefasst, aber den Sterbenden beizustehen, zählte zum ärztlichen Aufgabenfeld.[1] Auch die heutige Hospizbewegung und die Palliativmedizin setzen die soziale und ärztlich betreute Gestaltung des Sterbens gegen die medizinische Bekämpfung des Todes im Sinne einer verhinderbaren Krankheit, wo jedes Mittel recht geworden ist. Entsprechend geht es in der palliativ-hospizlichen Sorge um den Schutz und die Bettung von Menschen, die sich in der letzten Phase ihres Lebens befinden. Elisabeth Medicus erklärt den Grundsatz, das Sterben und das Lebensende als „eine kostbare Lebensphase“ für die Angehörigen und den betroffenen Menschen anzuerkennen. „Es ist wichtig, wie diese Zeit aussieht und wie sie gelebt wird. Auch für die Gemeinschaft, in der die Menschen leben, ist es absolut nicht egal.“
Was heißt das für das Sterben von Organspendern?
Die Todesfeststellung dieser Patienten beschränkt sich allein auf das Versagen des Gehirns, sodass „Hirntote“ für den Zweck der Organgewinnung intensivmedizinisch weiterbehandelt und operiert werden. Schließlich gilt nur ihr Gehirn als „tot“, ihr Körper aber weiterhin als lebendig. Der Sterbeort ist somit die Klinik und das Hirnversagen – der Eintritt des sogenannten „Hirntods“ – erfolgt auf der Intensivstation. Als Komapatienten befinden sie sich inmitten des eben beschriebenen Szenarios der Apparatemedizin. Sie bleiben trotz Todesbescheinigung künstlich beatmet, an Geräte angeschlossen. Die Vollendung ihres Sterbeprozesses darf mit allen Mitteln der intensivmedizinischen Kunst bis hin zu einer Reanimation aufgrund eines Herzversagens vor der Organgewinnung verhindert werden, denn die Organe müssen für deren Verpflanzbarkeit aus einem lebenden Körper stammen.
Obwohl mittlerweile die palliativ-hospizliche Sorge um Sterbende Einzug in die Krankenhäuser gehalten hat, verbietet sich eine solche Begleitung von Organspendern, denn sie ist zweckwidrig.
Eine Anästhesieschwester schildert die besondere Atmosphäre im Operationssaal, wenn ein Organspender den Herztod erleidet und sich in eine Leiche verwandelt: „In dieser Situation ist immer eine gewisse Spannung. Vorher ist man beschäftigt und gibt dem Patienten Medikamente, da ist etwas zu tun. Und dann kommt irgendwann der Augenblick, in dem der Patient sehr viel Blut verliert, und man steht daneben und schaut zu, wie das Herz aufhört zu schlagen. Für mich ist diese Situation furchtbar. […] Es schaut in diesem Moment so aus, als wenn ich erlebe, wie ein Patient stirbt. […] Da ist einem der Schauer über den Rücken gelaufen.“[2]
Ein palliativ betreutes Sterben auf der Intensivstation ist die Alternative zu dieser Todesart. Da die Palliativmedizin (lat. palliatio: „Bemäntelung“) grundsätzlich nicht für die Heilung eines schwer kranken Menschen, sondern ausschließlich für die Linderung seiner Beschwerden zuständig ist, zählt die medizinische, ebenso die psychologische und die soziale Begleitung von Patienten im finalen Stadium auf einer Intensivstation zu ihrem Aufgabenfeld. Wenn die Therapie beendet und dem Sterben freier Lauf gelassen wird, ist die Palliativmedizin darauf konzentriert, durch ärztliche Maßnahmen den Sterbeprozess zu erleichtern: Bevor alle lebensverlängernden Maßnahmen eingestellt werden, erhalten die Patienten Medikamente zur Beruhigung gegen Atemnot und Schmerzen (Analgosedation). Komapatienten mit drohendem oder bereits eingetretenem Hirnversagen, die für eine Organspende nicht zur Verfügung stehen, haben – wie alle anderen Patienten während der Beendigung ihrer Therapie auch – bei einem Behandlungsabbruch auf der Intensivstation einen Rechtsanspruch auf eine palliativmedizinische Betreuung.[3] Potenzielle Organspender hingegen, die sich zuvor für eine Explantation bereit erklärt haben oder dafür freigegeben worden sind, verlieren die Option einer palliativen Behandlung. Ebenso verzichten sie auf eine familiäre und
freundschaftliche Unterstützung. Die medizinische wie die soziale Gestaltung des Sterbens und des Todes von Organspendern ist ausschließlich von fremdnützigen Interessen bestimmt. Im Gegensatz dazu stehen in einem Hospiz und der palliativen Sorge um Sterbende, genauso wie ihre Familie und ihr Freundeskreis im Mittelpunkt des dramatischen Geschehens, auch in dem besonderen Moment, wenn sich eine Person vor aller Augen in einen Leichnam verwandelt.
Ist der Tod eines Menschen eingetreten, verändern sich – egal, ob in einer Institution oder in der häuslichen Umgebung – die Beziehungsstrukturen und die Atmosphäre im Sterbezimmer radikal. Für die Familie und den Freundeskreis beginnt nun eine gänzlich neue Phase: der Abschied von einem toten Menschen. Ab jetzt sind nur noch symbolische und spirituelle Kommunikationsformen möglich. Die Hospizärztin Elisabeth Medicus erklärt die hohe Bedeutung von Ritualisierungen dieses besonderen und hochdramatischen Augenblicks. Angehörige und der Freundeskreis müssen nun in eine neue Beziehung zu dem toten Menschen treten. Sie ist von Trennung, Erinnerung, Schmerz, Chaos und Trauer gezeichnet: „Für die Situation nach Eintritt des Todes eines Menschen haben wir ein paar Rituale entwickelt, die sich bewährt haben. Zunächst ermutigen wir die Angehörigen, einfach dazubleiben und wir ziehen uns zurück und kommen dann nach einer halben Stunde oder nach 20 Minuten mit einer Kerze mit dem Namen des Verstorbenen. Den Namen setzen wir aus ausgeschnittenen Wachsbuchstaben zusammen und er wird auf die Kerze geklebt. Das tröstet in diesem ersten Moment – denn das sagt: Dieser Mensch ist noch da. […] Später wird der Tote schön aufgebahrt, das Bett wird in einer passenden Bettwäsche neu bezogen, Blumen werden draufgelegt. […] Zur Realisierung des Todes ist es extrem hilfreich, die Gewissheit zu bekommen, diesen Menschen als Toten wirklich gesehen zu haben. Das weiß man ja auch von vermissten Menschen, dass es schwierig wird, einen Vermissten tatsächlich als Toten zu betrauern.“ Die noch vorhandene leibliche Gegenwart der Toten ist einzigartig und kann für die letzten Momente des Abschieds, die Realisierung des Todes eines Menschen im beginnenden Trauerprozess eine nicht zu unterschätzende Bedeutung haben. Es gehört zur Profession von Bestattern, ebenso wie zu dem in einem Hospiz palliativmedizinisch ausgebildeten Personal, die Angehörigen in dieser extremen Gefühlssituation zu unterstützen.
Eine Organentnahme hingegen durchkreuzt und verändert die ohnehin chaotische Situation und den Trauerprozess unerbittlich.
So müssen sich die Verwandten und der Freundeskreis von dem medizinisch erklärten toten Menschen auf der Intensivstation verabschieden. Er hat das Erscheinungsbild eines lebenden Menschen, sein Tod bleibt für Spezialisten wie für Laien abstrakt, er wird wie alle anderen Patienten ärztlich weiterbehandelt. Alexander von Hehl problematisiert aus der Perspektive eines Bestatters die Auswirkungen der paradoxalen Todesbotschaft auf den Trauerprozess: „Es ist für mich als Bestatter ein ganz wichtiger Punkt zu fragen: ‚Kann ich tatsächlich jemanden loslassen, wenn ich ihn noch atmen sehe?’ Ein Organspender wird beatmet und er sieht nicht so aus wie normalerweise ein Verstorbener.“ Karolina Müller und ihre Kinder hatten der Organspende ihres Ehemannes und Vaters zugestimmt. Nach der Hirntodfeststellung wurden sie aufgefordert, sich am Bett auf der Intensivstation zu verabschieden. Bis heute versteht Frau Müller nicht, warum ihr „toter“ Ehemann medizinisch und pflegerisch weiter betreut wurde: „Das hat mich sehr verwundert, weil ich mir gedacht habe: ‚Wenn er tot ist‘ – das mag vielleicht ein bisschen komisch klingen – ‚wozu dann Medikamente, wenn er tot ist?‘ Für mich war das unvorstellbar. Und noch unvorstellbarer und krasser war für mich, dass wir rausgehen mussten, weil er völlig neu gebettet wurde. […] Meine Tochter hat mir noch gesagt: ‚Die machen eben ihre Arbeit nach ihrem Rhythmus und für sie ist er noch Patient.‘“[4] Wie viele andere Hinterbliebene von Organspendern lehnte auch diese Familie einen Blick in den Sarg kategorisch ab, und Karolina Müller blieb lange Zeit von Zweifeln geplagt. Sie quälte sich mit der Frage, ob ihr Einverständnis für die Organentnahme ihres Mannes richtig und alles mit rechten Dingen zugegangen war.
Der Berliner Bestatter Alexander von Hehl kommentiert die aktuelle Diskussion über die Einführung der Widerspruchslösung vor dem Hintergrund solcher Eingriffe in den Trauerprozess kritisch. Denn die Seite der Hinterbliebenen bleibt gänzlich ignoriert. Die Frage nach einer Organspende wird von ihnen abgeschnitten und auf eine individuelle Entscheidung reduziert:
„Ich erlebe es immer wieder, dass man wirklich nur Abschied nehmen kann, wenn jemand definitiv tot ist und zwar so, wie wir das klassischerweise verstehen.“ (Bestatter)
„Ich rate Angehörigen auch immer dazu, wenn sie das können: ‚Fassen Sie den Verstorbenen an.‘ Denn einen Verstorbenen zu berühren, bedeutet, dass man über den Tastsinn den Tod erfährt und begreift. Der Tote hat eine andere Temperatur, die Haut fühlt sich anders an. Die Angehörigen müssen niemandem mehr glauben, dass derjenige tot ist, sondern sie haben es unmittelbar erfahren. Dieses Begreifen ist so wichtig, dass ich nicht weiß, ob das anders funktionieren kann. Kann ich bei einer Organspende wirklich loslassen, wenn ich an diesem Punkt nicht bin? Es gibt auch Leute, die ein Abschiednehmen am Sarg ablehnen, weil sie es nicht können oder wollen. Aber ich rate immer dazu, das zu tun, weil ich festgestellt habe, dass das ein zentraler Baustein in der Trauerbewältigung ist. Und diesen Baustein durch eine Organspende per Gesetz durch die Widerspruchslösung jemandem zu verwehren, weil ihm als Hinterbliebenen keine Entscheidung darüber zugestanden wird, sondern nur dem einzelnen Betroffenen vorweg, das finde ich unglaublich schwierig und das sehe ich sehr kritisch. Das soll nicht heißen, dass man es gar nicht machen sollte, nur denke ich, die Hinterbliebenen sind diejenigen, die auch mit den Bildern im Kopf weiterleben müssen.“
Organspende und Pietät
Die Operationslogik einer Organspende zwingt zur Aufgabe von Grundsätzen unserer Bestattungskultur, des Hospizgedankens, der Palliativmedizin und der Pietät. Der Begriff Pietät stammt aus dem Lateinischen (lat. pietas) und bedeutet „dankbare Liebe“, „Ehrfurcht“, „ehrerbietige Rücksichtnahme“. Er beinhaltet zwei sehr verschiedene Aufgabenbereiche, die nicht an spirituelle oder religiöse Vorstellungen gebunden sind: Pietät bezieht sich auf einen würdevollen Umgang mit den Toten, der auch in unserer säkularen Kultur in dem Recht auf Totenruhe gesetzlich verankert ist. Entsprechend gilt die Leichenschändung als eine Straftat. Die Störung der Totenruhe wird beispielsweise in Deutschland mit dem Paragrafen 168 (Österreich: §190 StGB, Schweiz: Art. 262 StGB) des Strafgesetzbuches mit bis zu drei Jahren Gefängnis und Geldstrafen geahndet. Über dieses Recht der Totenruhe verfügen die Verstorbenen einzigartig über den Tod hinaus.[5]
Außerdem umfasst Pietät den Schutz der Angehörigen in ihrer Trauer. Sie räumt den Verwandten eine zu respektierende Tabuzone und das juristisch zugestandene Recht auf ein ehrerbietendes Totengedenken ein. Entsprechend sind Bestattungsunternehmen zu einem pietätvollen Umgang sowohl mit den Toten als auch den Angehörigen verpflichtet. „Pietät heißt für mich Respekt vor dem Verstorbenen, vor den Hinterbliebenen, Respekt vor der Situation insgesamt, derdie Hinterbliebenen ausgesetzt sind,“ erläutert der österreichische Bestatter Stephan Sarg: „Pietät umfasst ihre Trauer, sie sind in einem Ausnahmezustand. Pietät bedeutet aber ebenso einen respektvollen Umgang mit den Verstorbenen, also dass man sie nicht umschmeißt und dass man sie gut herrichtet.“ Die im Rahmen einer Organgewinnung vorgenommene Zerstörung der leiblichen Integrität von Organspendern hingegen kündigt Regeln unserer Bestattungskultur sowie die anthropologisch verankerte „heilige Scheu“[6] vor dem Leichnam nicht nur auf, sondern kehrt sie in das Gegenteil um: In ein aggressives Verhältnis, das aus Tötungsriten des Krieges als Racheakt bekannt ist. Hier können die Leichen des Feindes Opfer einer Zerstückelung werden. Die Organgewinnung ist zwar dem hehren Ziel der Lebensrettung todkranker Menschen verpflichtet und gänzlich anders motiviert. Dennoch erlaubt eine Multiorgan- und Gewebeentnahme die Sektion (lat. sectio: „Zerteilen“) eines „hirntoten“ Patienten: Bei der üblichen Multiorganexplantation dürfen Spender in bis zu acht Organe zerlegt werden, nach dem Herztod im Rahmen der kommerzialisierten Gewebespende in weitere Fragmente – z. B. Knochen, Knorpel, Venen, Blutgefäße. Auch wenn für die Transplantationsmedizin rechtliche Ausnahmeregelungen gelten und der Rettung des Lebens anderer Menschen die Priorität eingeräumt worden ist, muss die Barriere der „heiligen Scheu“ vor dem Leichnam weiterhin überwunden werden. Denn Ekel, Ohnmacht, Erbrechen – also heftige körperliche Reaktionen – werden schon im Sektionskurs bei Studierenden der Medizin durch die Zerstörungshandlung des Leichnams ausgelöst, was auf die Macht des Todestabus und auf die hohe kulturelle Bedeutung der Totenfürsorge verweist. Die Verpflanzungsmedizin muss sich bei einer Multiorgan- und Gewebespende über das Todestabu hinwegsetzen. Im Vergleich zu Ärzten gelingt dem in seiner Ausbildung dafür nicht sozialisierten Pflegefachpersonal diese Tabuüberschreitung am wenigsten. So schildert ein Krankenpfleger, wie ihn Ekel überkam, als Gelenke eines Spenders explantiert wurden, „weil da einfach alles aufgeschnitten und ausgenommen wird. […] Wenn dann die ganzen anderen Teile noch mit herauskommen, dann ist das nur noch eine Hauthülle. […] Auch die anderen Sachen, also wenn sie mit Hammer und Meißel an einen Toten herangehen und handwerklich tätig sind, das hat für mich noch eine andere Qualität.“[7] Und selbst der Pionier der österreichischen Transplantationsmedizin Raimund Margreiter sträubte sich noch 1998, als die Transplantationsära von Extremitäten (Hände, Arme, Beine) gerade angebrochen war, gegen eine Knochenentnahme: „Wenn innere Organe entnommen werden, dann stört das ja im Prinzip den äußeren Aspekt nicht. Damit habe ich überhaupt keine Probleme. Aber wenn es darum geht, lange Röhrenknochen zu entnehmen, die dann nicht ersetzt werden, sodass ein Bein herunterfällt wie beim Hampelmann, das wäre etwas, das mich persönlich stören würde […] Dagegen wehre ich mich. Deswegen habe ich mich auch nie dazu entschließen können, ganze Gelenke zu entfernen.“[8] Diese Hemmung verlor Margreiter, als unter seiner Leitung am 7. März 2000 die weltweit dritte beidseitige Handtransplantation in der Innsbrucker Klinik durchgeführt wurde.
Die hospizliche und palliative Sorge ist darauf ausgerichtet, schwer kranken Menschen bis zum letzten Augenblick ihres Lebens beizustehen und ihnen ein Sterben in Würde zu ermöglichen. Bestattungssitten, das Gebot der Pietät, die Aufbahrung und das letzte Abschiednehmen von den Toten geben der aus den Fugen geratenen Beziehung zu einer gerade verstorbenen Person eine neue Ordnung – eine sinnlich erfahrbare Stütze für die Trauerbewältigung, die sich in das Leben der Hinterbliebenen für immer einschreibt. Sie schützt die Angehörigen und Sterbenden in einer Situation fundamentaler Verletzung, ebenso wie die Toten vor einer fremdnützigen Bemächtigung. Praktiken der Organgewinnung hingegen zerstören zugunsten einer profanen Verwertungslogik diese Kultur des Sterbens und des Todes.
Literatur
- Vgl. Stolberg, Michael: Die Geschichte der Palliativmedizin. Medizinische Sterbebegleitung von 1500 bis heute. Frankfurt am Main 2011, S. 21; Gronemeyer, Reimer / Heller, Andreas: In Ruhe sterben. Was wir uns wünschen und was die moderne Medizin nicht leisten kann. München 2014 ↑
- Zit. n. Baureithel, Ulrike / Bergmann, Anna: Herzloser Tod. Das Dilemma der Organspende. Stuttgart 1999, S. 171. Vgl. auch für das Folgende: Bergmann, Anna: Der entseelte Patient. Die moderne Medizin und der Tod. Stuttgart 2015, S. 256 – 307. ↑
- Vgl. Peters, Alexander / Wehn, Roland: Palliativmedizin: Wenn das Leben eines Patienten nicht mehr zu retten ist … Rechtsanwälte erläutern die derzeitige Rechtslage zur indirekten, aktiven und passiven Sterbehilfe. http://www.wernerschell.de/web/05/sterbehilfe.php (26.07.2019). „Bei einer schuldhaften Verletzung dieser Pflicht liegt eine strafbare Körperverletzung vor. Jeder Patient hat einen Anspruch auf Grundpflege und Leidensminderung“, erklären die Juristen Alexander Peters und Roland Wehn. ↑
- Zit. n. Bergmann, Anna: Organspenden zwischen animistischmagischen Todesvorstellungen und medizinischer Rationalität. In: Klinger, Cornelia (Hrsg.), Perspektiven des Todes in der modernen Gesellschaft. Wien/Berlin 2009, S. 24 – 55, hier S. 39. ↑
- Zum deutschen, österreichischen und schweizerischen Totenrecht und Pietätsverständnis vgl. Rüping, Hinrich: Materielles und Immaterielles im strafrechtlichen Schutz der Leiche. In: Bondolfi, Alberto / Kostka, Ulrike / Seelmann, Kurt (Hg.): Ethik und Recht. Bd. 1: Hirntod und Organspende. Tübingen / Basel 2004, S. 105 –118; für Deutschland, die Schweiz, die Niederlande vgl.: Forßbohm, Matthias: Selbstbestimmung wider das universelle Tötungsverbot: Betrachtungen zu medizinischen Entscheidungen am Lebensende und Ausnahmen vom generellen Lebensschutz in Deutschland, Schweiz und den Niederlanden. Technische Universität Dresden Phil. Diss. 2017, S. 61 – 80. http://tud.qucosa.de/api/qucosa%3A30559/attachment/ATT‑1/ (26. 07. 2019). ↑
- Zit. n. Mitscherlich, Alexander: Auf dem Weg zur vaterlosen Gesellschaft. Ideen zur Sozialpsychologie. München 1968, S. 260. ↑
- Zit. n. Baureithel/Bergmann 1999, S. 177; vgl. außerdem: ebd., S. 181f. ↑
- Zit. n. ebd., S. 177. ↑
Dieser Beitrag erschien auch in dem sehr lesenswerten Magazin
„Praxis PalliativeCare 44 / 2019 | Thema: Die ‚palliative‘ Seite der Organtransplantation„
Inhaltsverzeichnis (PDF, 129 kB)
Sie können dieses Heft direkt bestellen bei
https://www.praxis-palliativecare.de