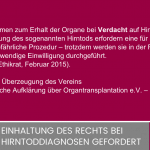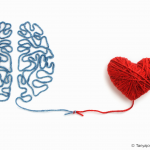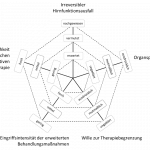Er verhandelte gerade einen Fall vor Gericht, als er sich an den Kopf griff und kollabierte. Massive Hirnblutung. Der 45jährige Rechtsanwalt wurde sofort in das Boston’s Brigham and Women’s Hospital eingeliefert.
Den Ärzten auf der Intensivstation war sofort klar, dass der Patient eine irreversible Hirnschädigung erlitten hatte; er würde nie wieder aufwachen. Sechs Tage später trafen seine Frau und seine beiden Kinder im Teenager-Alter die herzzerreissende Entscheidung, die lebenserhaltenden Maßnahmen zu beenden. Zumindest, so dachten sie. könnten sie den Wunsch ihres Ehemannes und Vaters erfüllen, der seine Organe spenden wollte.
Es war jedoch nicht so einfach.
Aufgrund einer nationalen Übereinkunft, auch als dead-donor-rule bezeichnet, durften die Transplantationsmediziner die Organe erst dann entnehmen, wenn der Patient tot war. Da er nicht alle Kriterien für die eine Todesdefinition – den Hirntod – erfüllte, gab es nur noch die Möglichkeit für die Familie, seine Organe nach dem Herzstillstand zu spenden.
Der Patient wurde in den OP gebracht, und seine künstliche Beatmung wurde abgebrochen. Dann begann die Wartezeit: Wenn das Herz innerhalb einer Stunde stehenblieb und nicht wenige Minuten später wieder spontan zu schlagen begann, dann würde der behandelnde Arzt ihn für tot erklären, und dann würden Transplantationschirurgen dazukommen und die brauchbaren Organe entnehmen. Wenn man noch länger wartete, dann würden die Organe wegen des schwachen Kreislaufs unbrauchbar werden.
Dreißig Minuten vergingen: Die Chance, eine tranplantierbare Leber entnehmen zu können, war verstrichen.
Sein Herz kämpfte und schlug immer noch.
45 Minuten vergingen. Sechzig Minuten. Nieren und Bauchspeicheldrüse waren nicht mehr brauchbar.
Nach 80 Minuten gab das Team die Hoffnung auf, sogar die robustesten Organe zu retten. Der Patient begann die Reise zurück auf die Intensivstation. Sein Herz blieb im Fahrstuhl stehen.
„Seine Frau war sehr aufgebracht. Die Ärzte waren aufgebracht“, daran erinnert sich Thomas Cochrane, Assistenz-Professor für Neurologie am Brigham and Women’s, der nach dem Vorfall mit der Familie sprach. „Sie konnte nicht verstehen, warum man die Organe ihres Mannes nicht herausnehmen konnte, bevor sein Herz aufgehört hatte zu schlagen. Niemand hatte etwas davon, dass die Dinge so abliefen.“
Auch 50 Jahre, nachdem die ersten Organtransplantationen vorgenommen wurden, bleibt die „dead-donor-rule“ ein heiß umstrittenes Thema in der Transplantations-Medizin. Sie ist ethischer Standard, kein Gesetz. Einige ihrer bekanntesten Kritiker sind an der Harvard Medical School zu finden. Ebenso auch einige ihrer hartnäckigsten Verfechter.
Schieben, Ziehen
Befürworter der Beibehaltung der „dead-donor-rule“ betonen, dass es das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Organtransplantation stärkt, indem man den potenziellen Spendern und ihren Angehörigen zusichert, dass die Organe erst dann entnommen werden, wenn derjenige für tot erklärt worden ist. Diese Dead-Donor-Rule überlässt die Verantwortung den Ärzten und Chirurgen, sicherzustellen, dass die Entnahme des Herzens oder der Lunge z.B. nicht den Tod eines Patienten verursacht. Vielleicht noch wichtiger: sie unterstreicht die zugrundeliegende medizinische Doktrin, dem Patienten keinen Schaden zuzufügen.
„Nach meiner Einschätzung auf der Skala zwischen Vertrauen und Zweckmäßigkeit ziehe ich Vertrauen vor“, sagt Francis Delmonico, HMS (Harvard Medical School)-Professor der Chirurgie, der auch am Massachusetts General Hospital tätig und Vorsitzender der „New England Organ Bank“ ist.
Kritiker heben hervor, dass der Schaden bereits eingetreten ist. Sterbende Patienten, die nicht den strengen Anforderungen der „dead-donor-rule“ entsprechen, die aber ihre Organe spenden wollen, werden daran gehindert. Ihre Angehörigen müssen einen doppelten Verlust erleiden, einen Tod ohne die Möglichkeit, andere zu retten. Manchmal bringt die Verpflichtung, sich an die Regeln zu halten, die Praktiker zur Verzweiflung und hält Patienten, die ihre Organe spenden wollen, davon ab und verschlechtert die Qualität der transplantierbaren Organe.
„Aus der Perspektive des Spenders kann die „dead donor rule“ mit den legitimen ethischen und medizinischen Zielen kollidieren“, sagt Cochrane, der auch Leiter der Abteilung für Neuroethik ist am HMS Center for Bioethics.
Eine lautstarke Minderheit, angeführt von Robert Truog, Leiter des HMS Center for Bioethics und des Frances Glessner Lee Professor of Medcal Ethics, Anaesthesia und Kinderheilkunde am HMS und Boston Children’s Hospital ist der Überzeugung, das medizinische Establishment sollte die „dead donor rule“ abschaffen und sich stattdessen darauf konzentrieren, den Schaden zu minimieren und stattdessen die Zustimmung zu maximieren.
„Mit einer klareren Vorgehensweise“, sagt Truog, könnten wir es den Menschen ermöglichen zu sterben, wie sie es wollen, wobei man ihnen gleichzeitig ermöglichen würde, ihren Wunsch nach Organspende zu erfüllen.“
Obwohl weiterentwickelte chirurgische Verfahren Transplantationen erfolgreicher gemacht haben, gibt es einen anhaltenden Mangel an inneren Organen. Die Abschaffung der „dead-donor-rule“ würde wohl einen Weg zu mehr Organspenden öffnen, aber Cochrane und Truog stellen klar, dass der entscheidende Grund für eine erneute Überprüfung nicht der Mangel an Organen ist, sondern eher die Absicht, den Patienten und den Ärzten gerecht zu werden und sich mit den sich verändernden Todesdefinitionen auseinanderzusetzen.
„Der Preis, den die Gesellschaft zahlt, indem sie darauf besteht, dass die Mediziner sich an die „dead-donor-rule“ halten, ist immens hoch“, sagt Daniel Wikler, Professor für Ethik und Gesundheitspolitik am Mary B. Saltonstall Population Health an der Harvard T.H. Chan School of Public Health.
Die Geburt des Todes
Einige sagen, dass diese Debatte in den späten 1960 er Jahren begann, als ein HMS Adhoc- Komittee unter Leitung von Henry Beecher, 32, damals HMS-Professor für Anaesthesiologie, sich dafür einsetzte, die Todesdefinition des Black‚s Law Dictionary auszuweiten und dabei auch das einzuschließen, was französische Mediziner als Koma depassé bezeichneten und was das Beecher-Komittee Hirntod nannte, d.h. den völligen und irreversiblen Verlust der Hirnfunktionen.
„Ein Organ, Gehirn oder anderes, das nicht mehr funktioniert und auch keine Möglichkeit hat, erneut zu funktionieren, ist für alle praktischen Zwecke tot“, schrieb das Komitee 1968 in JAMA. Dann beschrieben sie die Kriterien für die Festlegung, ob ein Gehirn für immer ausgefallen war.
Der „Uniform Determination of Death Act“, auch als UDDA bezeichnet, wurde zu Beginn der 1980er erlassen und von allen 50 Bundesstaaten verabschiedet und bestätigte die Entscheidung des Komitees, den Hirntod als eine von zwei juristischen Voraussetzungen für den eingetretenen Tod aufzuführen, neben der traditionellen Definition des irreversiblen Stillstands von Kreislauf und Atmung.
Diese beiden Regelungen, zusammen mit der Zustimmung der Angehörigen, ermöglichten es den Ärzten, bei juristisch für tot erklärten Patienten die lebenserhaltenden Maßnahmen zu beenden, wodurch sie weder einen Mord begingen noch sonst etwas Illegales taten. Somit legitimierten diese Festlegungen ein Lager von zur Spende geeigneten Organen, die immer noch ernährt und mit Sauerstoff versorgt wurden.
Ob die Teilnehmer des Beecher-Komitees oder des UDDA-Komitees durch das Ziel angetrieben wurden, den Vorrat an verfügbaren Organen zu steigern und ob sie die Definition des biologischen Todes so zurechtbogen, dass es dazu passte, bleibt eine Kontroverse.
Einige wenige Praktiker wie Truog sagen, dass das Komitee differenzierter hätte sein können. Sie hätten sagen können, dass Patienten ohne autonomen Kreislauf oder Atemfunktion und ohne Aussicht darauf, ihr Bewusstsein wieder zu erlangen, technisch gesehen noch am Leben sind, und es ethisch gerechtfertigt sei, ihre vitalen Organe zu entnehmen, wenn eine Zustimmung vorlag. Für die meisten Mediziner jedoch besteht kein Zweifel daran, dass sowohl der Hirntod als auch der Tod nach Kreislauf-Stillstand den wahren Tod bedeuten.
Wikler setzte sich mit diesen Fragen auseinander, als er Mitglied der „Presidential Commission“ war, die das UDDA entwarf. Er hatte ein Paper veröffentlicht, in dem er begründete, warum der Hirntod nicht als Tod bewertet werden sollte, aber Kollegen drängten ihn dazu, seine Position für den Bericht zu überdenken, oder er würde das Risiko eingehen, dass die Öffentlichkeit alarmiert würde.
Schließlich musste er sich der Frage stellen: „Was ist meine Priorität? Geht es mir darum, Leben zu retten oder darum, an meinen Überzeugungen festzuhalten?“ Er entschied sich: „Leben zu retten ist wichtiger.“
Dieser Standard wurde beibehalten: Der Tod des Spenders ist die einzige Möglichkeit, um vitale Organe gewinnen zu können.
„Möglicherweise wäre es auf lange Sicht besser gewesen, eher über die „dead-donor rule“ zu diskutieren als über den Hirntod“, sagt Cochrane.
Viele Wege führen zum Ziel
Der Hirntod ist nicht der einzige Aspekt der „dead-donor-rule“, der praktische und semantische Dilemmata hervorruft.
Es gibt keine genauen Statistiken darüber, wie viele Organe infolge warmer Ischämie verloren gegangen sind – eine Schädigung durch mangelhafte Durchblutung bei Körpertemperatur – aber ein Paper von 2014 im American Journal of Bioethics gab die Einschätzung, dass die Wartezeit auf den Herzstillstand nach Beendigung der lebenserhaltenden Maßnahmen und nach einer weiteren Wartezeit von einigen Minuten jährlich 2.200 Organe aus dem Organ-Pool unbrauchbar macht. Weitere 6.700 Organe gehen durchschnittlich jedes Jahr verloren, während man darauf wartet, dass die Spender mit schweren Hirnverletzungen in den Zustand des Hirntodes übergehen.
Die Anzahl der beschädigten oder unbrauchbaren Organe in Verbindung mit fehlendem eindeutigem Nachweis über die Mindestwartezeit, wonach ein nicht schlagendes Herz mutmaßlich nicht von allein wieder anfängt zu schlagen, hat einige Einrichtungen dazu gebracht, die Wartezeit nach Herzstillstand zu verkürzen. Diese schrumpfte an einer Klinik in Colorado z.B. von zwei Minuten auf 75 Sekunden.
Seitdem außerdem einige Herzen, die nach dem sogenannten Herztod entnommen wurden, transplantiert und wieder zum Schlagen gebracht werden können, sind Diskussionen entbrannt, ob der Spender wirklich tot war.
In geringer Anzahl hat sich landesweit auch die Organentnahme bei „unmittelbar bevorstehendem Tod“ entwickelt. Nach diesem Verfahren entnehmen die Chirurgen die Niere oder einen Leberlappen nach Zustimmung, lassen dem Patienten ein paar Tage zur „Erholung“ und beenden dann die künstliche Beatmung. Die Wartezeit soll nachweisen, dass die Organentnahme den Patienten nicht getötet hat.
Diese und andere Variationen „haben viele Menschen unangenehm berührt“, sagt Truog.
Truog trug mit dazu bei, das Verfahren bei der Spende nach Herztod am Boston Children’s Hospital einzuführen, und er gehört zu denen, die nicht viele Worte darüber verlieren. „Wir beachten die „dead donor rule“ hier“, sagt er. Stattdessen setzen er und seine Kollegen sich für Klarheit und Transparenz ein.
Öffentliche Meinungen
Diejenigen, die sich für die Abschaffung der „dead-donor-rule“ einsetzen, betonen, dass ein neues System besonders hohe Standards bei der Zustimmung erfordert und die Zusicherung, dass den Spendern kein Schaden zugefügt wird. Strenge medizinische, juristische und ethische Richtlinien müssten das sicherstellen.
„Unter Beachtung dieser Vorsichtsmaßnahmen stirbt kein Patient infolge der Organentnahme, der nicht auch sonst nach Beendigung der lebenserhaltenden Maßnahmen gestorben wäre“, schreibt Truog als Ko-Autor 2008 im New England Journal of Medicine.
Sorgfältig überarbeitete Vorschriften, so heißt es, würden dazu beitragen, dass verletzliche Menschen wie Demente und Geisteskranke geschützt werden, und auch verhindern, dass Menschen sich für eine Selbsttötung durch Organspende entscheiden.
Sogar bei diesen vorgeschlagenen Sicherheitsvorkehrungen hält die Angst vor öffentlicher Verurteilung beide Seiten davon ab, darüber in der Öffentlichkeit zu sprechen. Wenn man die Möglichkeit erwähnt, dass die Organe entnommen werden, bevor die Menschen tot sind, oder auch nur andeutet, dass es so schon geschehen könnte, würde das fragile Vertrauen erschüttert, das der Transplantationsmedizin seit den 60er Jahren entgegengebracht wurde.
„Wir wollen dies vermeiden“, sagt Wikler. „Die Organtransplantation ist mit einer der Gründe, dass wir dankbar sein können für die moderne Medizin.“
Aber würde dieses Vertrauen tatsächlich erschüttert werden? Vorsichtige Optimisten wie Truog und Cochrane verweisen auf Erfahrungen in den Kliniken, wonach die Angehörigen ihre hirntoten Angehörigen bezeichnen als „Sie werden durch künstliche Beatmung am Leben erhalten“, aber keine Bedenken haben, ihre Organe zur Spende freizugeben.
Einige wenige Studien haben versucht, die öffentliche Meinung einzuschätzen. In einer Umfrage unter tausend US-Bürgern, so der Bericht des Journal of Medical Ethics sagten 71 Prozent der Befragten, es sollte gesetzlich erlaubt sein, die Organe von Patienten im irreversiblen Koma zu entnehmen, auch wenn die Organspende ihren Tod herbeiführt; 67 Prozent sagten, sie würden in einer solchen Situation ihre Organe spenden. Allerdings ergab eine Umfrage von 2016 im Journal of Medicine and Philosophy, dass die Öffentlichkeit „zunehmend kritisch“ ist in Bezug auf Konflikte zwischen Organspende und Todesfeststellung.
Wartezeit?
Vor vierzig Jahren wurde die Beendungung von lebenserhaltenden Maßnahmen in hoffnungslosen Fällen für die entscheidende Todesursache gehalten. Im Lauf der Zeit wurden die Gesetze geändert, da Mediziner und Laien sich darauf einigten, dass der Zustand des Patienten die Todesursache war. Die gleiche Meinungsänderung könnte auch bei der Entnahme der Organe auftreten.
Wenn Organbanken und Politiker konservativ bleiben bei ihren Bemühungen, lebensfähige Organe entnehmen zu dürfen, dann liegt dies daran, dass die medizinische Praxis sich langsam umstellen muss und darauf wartet, dass sich die medizinischen und gesellschaftlichen Anschauungen ändern.
Während sie auf diese Chance warten, könnten Kritiker der „dead-donor-rule“ das eine denken und das andere tun.
„Ich bin irgendwie zweigeteilt“, sagt Truog. „Als Intensivmediziner muss ich mich an den „status quo“ halten. In Gesprächen mit Kollegen und wenn ich unterrichte, rede ich anders darüber.“
Vielleicht muss die dead-donor-rule, so fragil sie auch sein mag, noch weitere zehn oder 20 Jahre Gültigkeit haben, bis die eine oder andere Forschung eine andere Versorgung mit Organen ermöglicht.
„Wenn Organe nur von Schweinen stammten, benötigten wir keine Diagnose wie den „Hirntod“ mehr“, so Truog. „Vielleicht sollten wir einfach noch warten.“
Aber auf den technologischen „deus ex machina“ zu warten ist nicht für jeden das Richtige. „Ich hoffe, das geschieht bald, weil jeder davon profitieren wird“, sagt Cochrane, „und gleichzeitig möchte ich nicht, dass dies passiert, weil diese Form der Ethik noch auf ihre Erfolge hin überprüft werden muss.“
Wenn eines Tages Ärzte, Chirurgen, Patienten, Familien, Rechtsanwälte, Politiker, Ethiker und andere darin übereinstimmen, dass eine Überwindung der „dead-donor-rule“ besser wäre als sie beizubehalten, dann gäbe es Grund zum Feiern und um sich Sorgen zu machen. Die Schlacht um Definitionen und mehr Patienten-Autonomie wäre gewonnen, aber dann müsste die schwere Aufgabe, sie anzuwenden, in Angriff genommen werden.
Stephanie Dutchen schreibt wissenschaftliche Texte für das Büro für Kommunikation und Außenbeziehungen der Harvard Medical School (HMS Office of Communication and External Relations).
Englischsprachiger Originaltext
A Fine Line- Is it time to reconsider the dead-donor rule?
by Stephanie Dutchen
Published online: Autumn 2016
in Ethics of Harvard Medizine Magazine
Deutsche Übersetzung
Renate Focke