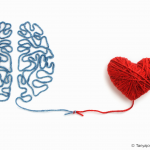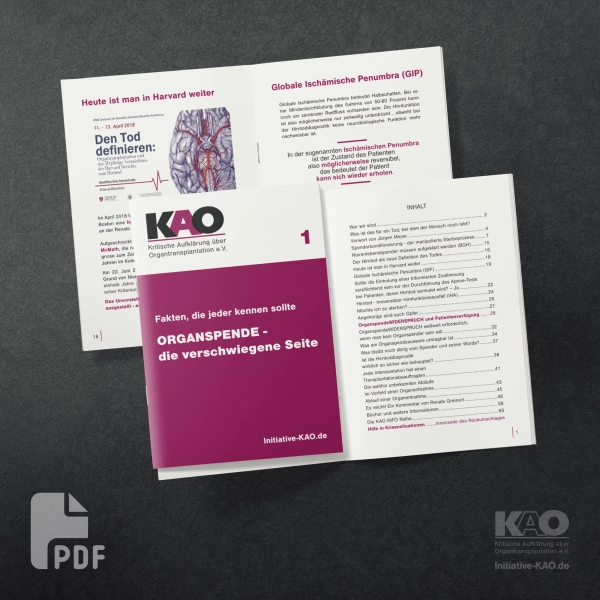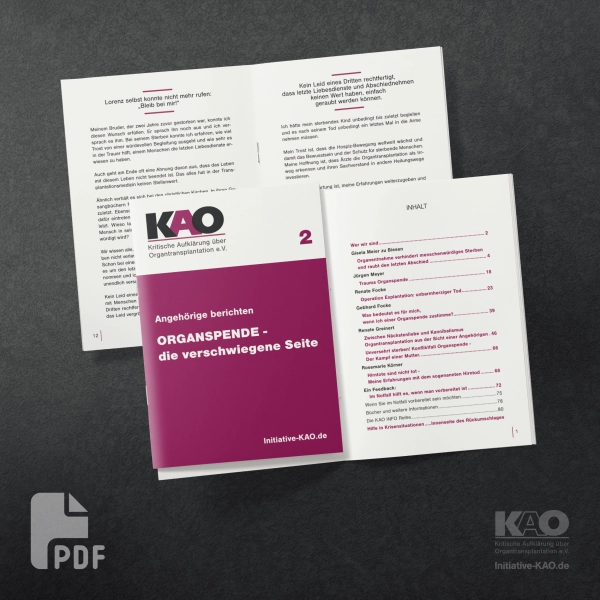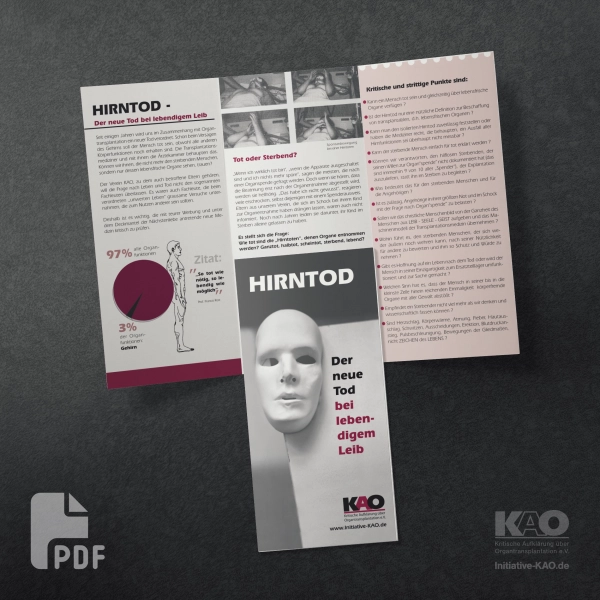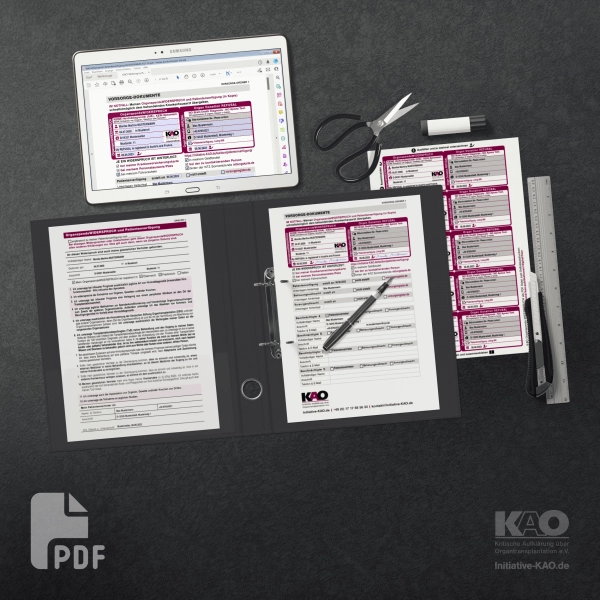Der Bundesrat fordert mit dem Entwurf eines Gesetzes zur Einführung der Widerspruchslösung (Bundestag Drs. 20/12609) eine Novellierung des Transplantationsgesetzes, um die just am 1. März 2022 in Kraft getretene, umfangreich reformierte Entscheidungslösung abzuschaffen. Diese Regelung beruht auf der seit 1997 gültigen Erweiterten Zustimmungslösung, die sich noch auf die im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) verankerten Patientenrechte bezieht: Behandelnde Ärztinnen und Ärzte sind grundsätzlich verpflichtet, eine informierte Einwilligung zu medizinischen Maßnahmen einzuholen. Denn jeder ärztliche Heileingriff gilt zunächst als Tatbestand einer Körperverletzung (z.B. Operationen, diagnostische, Injektionen, Verabreichung von Medikamenten). Sind Patienten nicht zustimmungsfähig und liegt von ihnen keine Patientenverfügung (§ 1827 Abs. 1 S. 1 BGB) vor, in der die betreffenden Maßnahmen gestattet oder untersagt sind (§ 630d Abs. 1 S. 1 und 2 BGB), muss bei einer dazu berechtigten Person – einem Bevollmächtigtem oder Betreuer – das Einverständnis eingeholt werden.
Dies gilt auch für eine Organspende. Denn die Möglichkeit einer Organentnahme wird in einer hochkomplexen Behandlungssituation auf der Intensivstation noch zu Lebzeiten von potenziellen Organspendern besprochen und entschieden. Die betreffenden Komapatienten befinden sich in dieser Phase als Sterbende nicht nur medizinisch, sondern auch juristisch im Status von lebenden Menschen. Unabhängig von ihren besonderen Eigenschaften, genießen sie das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 S. 1 Grundgesetz).
Hinzu tritt die Besonderheit einer Organspende: Im Rahmen des sog. Organspendeprozesses erfolgen sämtliche ärztlichen Eingriffe nicht als heiltherapeutische Maßnahmen zum Wohl der betreffenden Patienten. Das speziell auf die Organspende zugeschnittene intensivmedizinische Behandlungskonzept wird in der Regel bereits vor der (Hirn-)Todesfeststellung eingeleitet und dient dem alleinigen Fremdzweck: der Gewinnung von Organen zugunsten anderer Patienten.
Widerspruchslösung – die konsequente Ignoranz medizinethischer Rechtsnormen und Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuches
Die Einführung der Widerspruchslösung käme einer großen Wende in der Praxis der Organgewinnung gleich, denn jeder Bundesbürger dürfte automatisch zum potenziellen Organspender gemacht und einer Organ- und Gewebeentnahme unterzogen werden – es sei denn, er hat vorher aktiv widersprochen. Diese Regelung würde die im BGB verankerten Patientenrechte und medizinrechtlichen Regelungen zur Behandlungseinwilligung aushöhlen. Vertreter der Widerspruchsregelung nehmen für das Ziel ‚Erhöhung der Organspenderzahlen‘ eine Entrechtung der Patienten und ihrer Angehörigen in Kauf. Sie erlauben sich eine konsequente Ignoranz der Grundsätze der Patientenautonomie, der medizinischen Ethik, aber auch der Rechte von Angehörigen eines sterbenden und toten Menschen.
Dazu zählen:
- die ärztliche Aufklärungspflicht bei medizinischen Eingriffen;
- das Selbstbestimmungsrecht von Patienten (Patientenautonomie);
- Grundsätze der ärztlichen Sterbebegleitung;
- das über den Tod hinausreichende Persönlichkeitsrecht und der Schutz der Totenruhe;
- das Recht der Angehörigen auf Totenfürsorge und Wahrung der Pietät;
- das elterliche Sorgerecht für Minderjährige ab dem 14. vollendeten Lebensjahr;
- das ärztliche Gelöbnis, jede medizinische Handlung ausschließlich auf das Wohl des behandelten Patienten auszurichten.
Widerspruchslösung – eine Demontage der gesetzlichen Regelungen zur Aufklärung und Einwilligung bei medizinischen Eingriffen
Die ärztliche Aufklärung muss eine verständliche Erklärung von sämtlichen Umständen der medizinischen Behandlung beinhalten (§ 630e Abs. 1 S. 1 u. 2 BGB), um eine Grundlage für die Einwilligungsfähigkeit und selbstverantwortliche Entscheidungsfreiheit der Patienten zu bilden.
Für die therapeutischen Behandlungsschritte im Rahmen einer Organspende heißt dies: Die eigens für die Explantation entwickelte ‚spendezentrierte Therapie‘ von potenziellen Organspendern beginnt nicht erst mit der chirurgischen Entfernung einzelner Organe im Operationssaal, sondern sehr viel früher auf der Intensivstation: Wenn sich herausstellt, dass die Intensivmedizin das Leben von Komapatienten mit einer Hirnschädigung z.B. nach einer Hirnblutung, Sportverletzung oder einem Schlaganfall nicht mehr retten kann, ist in Absprache mit den Angehörigen von den behandelnden Ärzten der mutmaßliche Patientenwille zu ermitteln, um die weitere Behandlung des sterbenden Menschen in die Wege leiten zu können.
Wie auch das reformierte Transplantationsgesetz durch die zeitlich vorverlegte Berechtigung zur Einsicht in das Organ- und Gewebespenderegister (§ 2a Abs. 4 S. 2 Nr. 2 TPG-2021) sowie die vorgezogene Auskunftspflicht der Entnahmekrankenhäuser gegenüber der Transplantationsmedizin erlaubt (§ 7 Abs. 3 S. 4 TPG-2021), ist noch zu Lebzeiten der Patienten zu entscheiden, ob sie als potentielle Organspender bis zur Hirntoddiagnostik einer Spenderkonditionierung unterzogen und lebensverlängernd weiterbehandelt werden. Oder gibt der mutmaßliche Patientenwille vor, keine Organspende zuzulassen, kommt diesen Patienten eine palliativmedizinische Sterbebegleitung zugute, an der auch die Familie mitwirken kann.
Grundsätzlich zählt zur ärztlichen Aufklärungspflicht, auf alternative Behandlungsmöglichkeiten hinzuweisen (§ 630e Abs. 1 S. 3 BGB). Die Alternative zu einer Organspende stellt die palliativmedizinische Sterbebegleitung dar. Auf diesen springenden Punkt machte auch die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensivmedizin- und Notfallmedizin (DIVI) anlässlich der Reform des Transplantationsgesetzes von 2019 aufmerksam: „Die Einleitung einer palliativmedizinischen Behandlung würde die Realisierung einer Organspende verhindern.“ (S. 3)
Das palliative Behandlungskonzept (lat. ‚palliare’: mit einem Mantel umhüllen) verzichtet bereits in der Phase, wenn sich ein Hirnversagen abzeichnet, auf sinnlos gewordene, lebenserhaltende medizinische Maßnahmen. Sie richtet den Fokus auf eine leidensmindernde Therapie und hat eine ärztliche, spirituelle sowie psychosoziale Betreuung des sterbenden Menschen, aber auch seiner Angehörigen im Blick. Insofern unterscheidet sich der letzte Weg von Organspendern drastisch von dem Sterben eines palliativmedizinisch und familiär begleiteten Menschen.
Widerspruchslösung – ohne Zustimmung zur „spendezentrierten“ Intensivtherapie und anästhesiologisch betreuten Organentnahme
Eine Organspende von Intensivpatienten mit einer schweren Hirnschädigung kann grundsätzlich nur unter folgenden Bedingungen stattfinden:
- wenn die maximaltherapeutische Lebensverlängerung bis zum feststellbaren ‚Hirntod‘ weitergeführt wird, so dass alle Kriterien für das Hirnversagen erfüllt sind (Todeszeitpunkt: die letzte Unterschrift des zweiten Hirntoddiagnostikers auf dem Hirntodprotokoll). Für diese Zeitspanne, die unter dem ethisch problematischen „Therapieziel Hirntod“ steht, hat die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) einen Textbaustein extra für Patientenverfügungen (S. 14) entwickelt, um ein rechtswirksames Einverständnis für diese bereits „vor dem Tod“ beginnende Therapie einzuholen. Eine in derselben Patientenverfügung zuvor festgelegte Ablehnung von einer sinnlos gewordenen intensivmedizinischen Lebenserhaltung wird durch diesen Textbaustein zugunsten des Patientenwillens (Patientenautonomie) ‚Organspende‘ wieder aufgehoben;
- wenn die vorausgegangene sedierende und schmerzlindernde Behandlung abgesetzt wird, um die zweifach vorgeschriebene, den Komapatienten herausfordernde Hirntodfeststellung durchführen zu können (z.B. Schmerzprovokation des Trigeminusnerves etwa durch einen Stich in die Nasenwurzel, Eiswasserspülung der Ohren, Kneifen etc.);
- wenn nach der Hirntoddiagnostik zwecks Aufrechterhaltung des ‚lebendigen Körpers‘ einer als tot geltenden Person die ‚spendezentrierte‘ Therapie weitergeführt wird. Diese Behandlung kann Maßnahmen mit einer hochgradigen Eingriffsintensität (S. 323) umfassen (z.B. eine Herz-Lungen-Wiederbelebung, Operationen, Verabreichung gefäßaktiver Medikamente; Austausch von mindestens einem Blutvolumen; Operationen; Organersatztherapien z.B. für Nieren, Leber);
- wenn Anästhesisten an der großen, mehrstündigen Multiorganentnahme von bis zu sieben Organen mitwirken (Herz, Lungen, Darm, Leber, Bauchspeicheldrüse, zwei Nieren, außerdem Anteile der Milz oder Lymphknoten zur Gewebetypisierung). Sie verabreichen entweder Medikamente zur Unterdrückung von Bewegungen (Muskelrelaxanzien) und Schmerzmittel (Opioide) oder führen eine Narkose durch (S. 388 f.).
Widerspruchslösung – die Missachtung von Grundsätzen der ärztlichen Sterbebegleitung
Der Verzicht auf ein Maximum von medizinisch-technischen Maßnahmen der künstlichen Lebensverlängerung ist mittlerweile einhellig nicht nur gestattet, sondern vorgeschrieben. Auch für den Umgang mit sterbenden Intensivpatienten mit einer schweren Hirnschädigung gelten die Leitlinien der Anästhesiologie, der Notfall- und Intensivmedizin, alle mechanischen, elektrischen und medikamentösen lebenserhaltenden Therapien zu beenden. In den Empfehlungen der DIVI (S. 50) heißt es: „Maßnahmen, die ausschließlich zu einer Verlängerung des Sterbeprozesses führen, sind unzulässig.“ Zudem ist ein an Fremdzwecken orientierter Umgang mit sterbenden Patienten verboten: „Die Interessen des Sterbenden dürfen keinem anderen Zweck, welcher Art auch immer, untergeordnet werden.“ (S. 51)
Eine intensivtherapeutische Weiterbehandlung, die aufgrund der infausten Prognose aussichtslos ist und daher jeden weiteren Rettungsversuch des Lebens eines Patienten sinnlos macht, bewegt sich, so auch der Internist und Chefarzt der Medizinischen Klinik im Ketteler Krankenhaus Offenbach Stephan Sahm, „an der Grenze zum Tatbestand der Körperverletzung“. “(FAZ vom 30.10.2018) Die Widerspruchslösung würde die Zustimmungspflichtigkeit und das Selbstbestimmungsrecht von Patienten für solche fremdnützigen medizinischen Eingriffe aufheben.
Widerspruchslösung: Gewebeentnahme nach dem Tod – Die Außerkraftsetzung des Rechts auf Totenruhe und des Rechts der Angehörigen auf Totenfürsorge
Da die Transplantationsmedizin auf einer verengten, bis heute international umstrittenen Todesdefinition beruht, bleibt die Operation der Organentnahmen von den Straftatbeständen der vorsätzlichen und fahrlässigen Tötung sowie der Körperverletzung unberührt. Ab dem Zeitpunkt der abgeschlossenen Hirntoddiagnostik gilt für den im Rechtsstatus einer Leiche sich befindenden ‚hirntoten‘ Patienten zunächst nur, dass der strafrechtliche Schutz der Totenruhe wirksam wird, ebenso das Recht der totenfürsorgeberechtigten Angehörigen auf einen pietätvollen Umgang. Aus dem in Bestattungsgesetzgebungen verankerten Persönlichkeitsrecht, das die Wahrung der Menschenwürde über den Tod hinaus gewährleistet, leitet sich die Strafbarkeit der Störung der Totenruhe ab (§ 168 StGB).
Nur wenn zu Lebzeiten einer Organ- und Gewebespende zugestimmt wurde, ist der Persönlichkeitsschutz nach dem Tode durch das Selbstbestimmungsrecht ‚der Verstorbenen‘ relativiert und die Behandlung des ‚Leichnams‘ als Sache gestattet.
Für Gewebeentnahmen heißt dies: Im Gegensatz zu den am lebenden Körper durchgeführten Organexplantationen erfolgt die Entnahme von Gewebe erst, nachdem Organspender auf dem Operationstisch das Erscheinungsbild einer Leiche angenommen haben (z.B. Atemstillstand, Totenflecke, Leichenstarre). Gewebeentnahmen sind größtenteils bis zu 72 Stunden nach dem Herztod durchführbar. Liegt die Erlaubnis für eine Gewebespende vor, dürfen selbst bei hochbetagten Spendern Knochen (Beckenkamm, Röhrenknochen, ganze Gelenke etc.), Haut, Bänder, Muskeln, Rippenknorpel, Blutgefäße (Arterien, Venen), Weichteilgewebe (Sehnen, Bindegewebe), Augenhornhäute oder Herzklappen entnommen und als Gewebe industriell weiterverarbeitet werden.
Die Widerspruchslösung würde das Selbstbestimmungs- und das Totenrecht, aber auch das Recht auf Totenfürsorge der Angehörigen hinfällig machen (Schutz vor dem Straftatbestand der Störung der Totenruhe, im Volksmund: ‚Leichenschändung‘).
Widerspruchslösung – die Entrechtung der Eltern von Minderjährigen
Nur Volljährige sind dazu berechtigt, eine rechtswirksame Patientenverfügung zu verfassen (§ 1827 Abs. 1 BGB) oder sich für eine Körperspende für Anatomische Institute zu entscheiden. Hingegen sieht der Gesetzentwurf (Bundestag Drs. 20/12609, S. 9) zur Einführung der Widerspruchslösung vor, auch Minderjährige ab dem 14. vollendeten Lebensjahr automatisch zu Organ- und Gewebespendern zu machen, es sei denn, sie haben zu Lebzeiten ihre Ablehnung dokumentiert.
Laut der momentan geltenden Entscheidungsregelung sind Jugendliche ab dem 16. Lebensjahr dazu befugt, ihre Bereitschaft zu einer Organ- und Gewebespende zu erklären. Die im Gesetzentwurf vorgesehene Herabsetzung des Alters von Minderjährigen auf 14 Jahre macht eines deutlich: Die im BGB verankerten Patientenrechte stehen schon jetzt nicht in Einklang mit der Transplantationsgesetzgebung, denn sie behandelt die juristische Regelung der Organ- und Gewebespende wie einen vom BGB unabhängigen Rechtsbereich. Die Widerspruchslösung würde diese Kluft verschärfen und damit auch das elterliche Sorgerecht (§§ 1627, 1629 Abs. 1 BGB) für Minderjährige ab dem 14. Lebensjahr hinsichtlich der Gestaltung des Sterbeprozesses weiter einengen. Dazu zählt die Entscheidung über eine familiär und ärztlich begleitete Palliativbehandlung versus eine spendezentrierte Therapie unter Ausschluss der Angehörigen. Auch wäre Eltern das Sorgerecht hinsichtlich der Eröffnung des Körpers ihrer Kinder (ab 14 Jahren) und seiner Zergliederung in einzelne Organe sowie Gewebe genommen.
‚Gewebespende‘ – das Geschäft mit menschlichem Gewebe
Die Gewebegewinnung ist zwar ein ureigener Bereich der unter einem Handelsverbot stehenden Organverpflanzungsmedizin. Doch in den letzten Jahrzehnten hat sich daraus ein eigenständiger Zweig entwickelt, den die Deutsche Gesellschaft für Gewebetransplantation mbH (DGFG) organisiert. Obwohl in der Werbung für die Gewebespende hervorgehoben wird, sie sei frei von kommerziellen Interessen, unterliegt menschliches Gewebe dem Arzneimittelgesetz (AMG) (§ 4 Abs. 30 AMG). Dadurch ist das für Organe geltende Handelsverbot aufgehoben, so dass die mit einem industriellen Verfahren verarbeitete ‚Gewebespende‘ auch kommerziell nutzbar ist (§§ 21,21a AMG). Die gewinnträchtige Weiterverarbeitung von menschlichem Gewebe expandiert kontinuierlich.
So liegt der Anteil jener Menschen, die auf einer Intensivstation noch vor dem Herztod ein Organversagen des Gehirns (‚Hirntod’) erleiden, unter den Verstorbenen nur bei etwa 0,3 Prozent. Dagegen ist das Potenzial von Gewebespendern ungleich viel größer. Immerhin kommen für eine Gewebeentnahme zirka 80 Prozent der in Kliniken verstorbenen Patienten in Betracht. Zudem können Gewebespendermeldungen auch von Bestattungsinstituten, Pflegeeinrichtungen, Hospizen oder Notärzten erfolgen. So wurden 2023 in Deutschland 965 Intensivpatienten mit einer schweren Hirnschädigung zu Organspendern, von denen 432 auch als Gewebespender dienten (44,8 Prozent). Hingegen gab es im selben Jahr 3.305 Gewebespender (S. 9), unter ihnen waren 12,3 Prozent gleichzeitig Organspender.
Die Widerspruchslösung würde ohne vorherige Zustimmung der Verstorbenen die Gewebeentnahme (z.B. Knochen, Meniskus, Blutgefäße) erlauben. Die kommerzialisierbare Gewebegewinnung könnte unter dieser gesetzlichen Bedingung erheblich potenziert werden.
Widerspruchslösung – Ignoranz des ärztlichen Gelöbnisses
Nach den Erfahrungen mit den medizinischen Verbrechen durch hochrangige Wissenschaftler im Nationalsozialismus wurde 1948 das Genfer Gelöbnis als eine moderne Fassung des Hippokratischen Eides auf internationaler Ebene eingeführt. Diese Deklaration des Weltärztebundes verpflichtet ärztliches Handeln darauf, ausschließlich für die Gesundheit und das Wohlergehen des einzelnen Patienten Sorge zu tragen. Medizinische Maßnahmen, die nicht am Wohl der anvertrauten Patienten orientiert und von Fremdinteressen geleitet sind, werden seither ethisch verworfen, es sei denn, Patienten dokumentieren ihr Einverständnis (z.B. Teilnahme an Studien, Organspende).
Solange die Transplantationsmedizin auf die Nutzung des Körpers sterbender Menschen angewiesen ist, steht das Genfer Gelöbnis in gewisser Weise im Widerspruch zu den Methoden der Organgewinnung. So sah der Düsseldorfer Professor der Chirurgie und Nobelpreisträger Werner Forßmann (1904 – 1979) anlässlich der 1968 in Kapstadt erfolgten Herztransplantationen die Grundsätze der medizinischen Ethik bedroht und schrieb im Berliner Tagesspiegel:
„Man stelle sich vor, daß womöglich in irgendeiner Klinik Ärzte sehnsüchtig auf Unfallverletzte warten, nicht um ihnen zu helfen und sie zu heilen, sondern um ihren Körper und damit ihre Individualität zu Material zu erniedrigen. […] Hier wird in letzter Konsequenz der Arzt zum Henker herabgewürdigt, ein Luzifer, ein gefallener Engel.“ (Nr. 6784, 04. Jan. 1968)
Unter den gesetzlichen Bedingungen der Widerspruchslösung ginge Forßmanns Schreckensvision in Erfüllung. Schließlich wären dann sämtliche medizinischen Handlungen gegenüber sterbenden Intensivpatienten mit einer schweren Hirnschädigung auf transplantationsmedizinische Fremdinteressen auszurichten. Der staatliche Auftrag, ohne Zustimmung der betreffenden Patienten die spendezentrierte Therapie und die große Operation der Organentnahmen bei lebendigem Leib durchzuführen, untergräbt das Genfer Gelöbnis: die Verpflichtung auf die ärztliche Schutzfunktion zum Wohle des behandelten Patienten.
Das ärztliche Gelöbnis und das von der Intensivmedizin verursachte Spendermeldedefizit
Vor dem Hintergrund dieser medizinethischen Verpflichtung wird plausibel, warum es bei dem Intensivpersonal bis auf den heutigen Tag Widerstände gibt, Patienten überhaupt als potenzielle Organspender wahrzunehmen und für die Einleitung einer fremdnützigen Therapie durch eine Spendermeldung bei der Deutschen Gesellschaft Organtransplantation (DSO) initiativ zu werden. Nicht etwa nur die immer ins Feld geführte ‚geringe Organspendebereitschaft‘ der Bevölkerung, sondern auch die niedrige Beteiligung von Intensivärzten an Spendermeldungen wird in der Fachliteratur seit Jahrzehnten als Ursache ‚des Organmangels‘ moniert.
2003 meldeten ganze 60 Prozent der deutschen Kliniken mit einer intensivmedizinischen Versorgung (S. B 212) keine potenziellen Spender. Auch 2016 kooperierten 56 Prozent der Intensivstationen von sog. Entnahmekrankenhäuser nicht mit der DSO (S. 27). Um diese Situation zu ändern, wurde 2019 gegen die geringe Beteiligung der Intensivmedizin an der Spenderrekrutierung das Gesetz zur Verbesserung der Zusammenarbeit und der Strukturen bei der Organspende verabschiedet und ein strengeres Kontrollsystem zur sog. ‚Spenderdetektion‘ etabliert. Doch die Klage über das Meldedefizit ist auch noch 2021 im Deutschen Ärzteblatt zu lesen: „Die Mehrzahl der Entnahmekrankenhäuser erkennt und meldet keinen einzigen Patienten mit möglichem IHA [irreversiblen Hirnfunktionsausfall].“ (S. 684)
Die Widerspruchslösung würde die ärztliche Verantwortung der Intensivmedizin für ihre Patienten am Lebensende und die Autonomie gegenüber der Transplantationsmedizin noch weiter einschränken.
Der weltweit beklagte ‚Tod auf der Warteliste‘ – Organmangel und Strategien zur Vergrößerung des sog. Spenderpools
Der von der Verpflanzungsmedizin international beklagte ‚Organmangel‘ scheint ein nicht auflösbares, strukturelles Problem des Transplantationssystems insgesamt zu sein. Zum einen erzeugt es immanent einen immer größeren Bedarf an Organen – etwa durch die Indikationserweiterung für die Verpflanzung von vorgeschädigten, sog. ‚marginalen Organen‘ (z.B. Fettlebern, Raucherlungen, Organe mit Konservierungsschäden), außerdem durch Abstoßungen der transplantierten Organe von Empfängern auch trotz der tagtäglichen Medikamenteneinnahme zur Unterdrückung des Immunsystems. Teilweise müssen Organempfänger ein zweites oder gar drittes Mal transplantiert werden.
Zum anderen ist die Gefahr, auf der Intensivstation einen ‚Hirntod‘ zu erleiden, sehr gering. Vor diesem Hintergrund bleibt das politisch gesteckte Ziel einer ‚leeren Warteliste‘, wie der ehemalige Chefarzt der Medizinischen Klinik in Gladbeck Linus Geisler erklärte, „immer eine Illusion“. Aber angesichts der großen Diskrepanz zwischen dem stets wachsenden Spenderbedarf und den verfügbaren ‚Organressourcen‘ werden seit Jahrzehnten immer wieder neue Konzepte zur Vergrößerung des ‚Spenderpools‘ entwickelt. Neben der Widerspruchslösung zählen dazu:
- die Einführung einer neuen Spenderkategorie, bei der das Hirntodkriterium aufgegeben worden ist: Die sog. Non Heart Beating Donors (NHBD: Organspender ohne schlagende Herzen; aktueller Begriff: Donation after circulatory death: DCD). Bei einem großen Teil der DCD-Multiorganspender (Maastricht Kategorie III) werden im Rahmen eines Behandlungsabbruchs ein ‚kontrollierter Herzstillstand‘ hergestellt und teilweise, um eine Autoreanimation zu vermeiden, vor der Organentnahme die Durchblutung des Gehirns unterbunden. In den Niederlanden übertraf 2023 der Anteil der DCD mit 62,33 Prozent sogar die Zahl von ‚Organspendern nach Hirntod‘. So auch in Belgien: hier erfolgte eine DCD bei 54,20 Prozent aller Organspender (Eurotransplant Annual Report 2023, Tabelle 2.4.2.).
Die DCD-Methode wurde in Deutschland von der Zentralen Ethikkommission als Tötung ethisch verworfen. Ebenso missbilligte 2015 der Deutsche Ethikrat mehrheitlich die Erweiterung der Organgewinnung um Non Heart Beating Donors. Hingegen plädierten im Zuge des internationalen Diskurses über diese Spenderkategorie die amerikanischen Bioethiker Robert D. Truog und Franklin G. Miller für eine grundsätzliche Abschaffung der ‚Tote-Spender-Regel‘. Daher sprechen sie auch hinsichtlich der verengten Hirntodvereinbarung unverblümt von einem „justified killing“ (S. 42) – dem „gerechtfertigten Töten“, um den weltweit herrschenden ‚Organmangel‘ zu mindern; - die in einigen europäischen Ländern und Mitgliedstaaten von Eurotransplant bereits legalisierte Kombination von aktiver Sterbehilfe mit der Methode der DCD-Organgewinnung – so in Belgien, den Niederlanden, ebenso in Spanien und Kanada;
- die Forderung nach einer Legalisierung der „Organspende-Euthanasie“ („Organ Donation Euthanasia”).
Die bedingungslose Steigerung der Transplantationszahlen: das Old-for-Old Programm – ‚Marginale Spenderorgane‘ für ‚Marginale Organempfänger‘
Wie unerbittlich das Transplantationssystem auf eine maximale Steigerung von Spenderzahlen erpicht ist, wurde auch in der Corona-Pandemie offenbar. So scheute die internationale Transplantationsmedizin nicht davor zurück, auf Intensivstationen sogar nach potenziellen ‚Organspendern‘ unter Coronakranken Ausschau zu halten. Auch meldet das Deutsche Ärzteblatt, eine SARS-CoV‑2 Infektion von ‚hirntoten‘ Patienten stelle kein Hindernis für die Transplantation ihrer Organe dar.
Diese Verpflanzungspraxis ist eingebunden in das seit Ende der 1990er Jahre von Eurotransplant entwickelte Konzept der Organbeschaffung: das „Sonderprogramm für Senioren-Patienten“ – geführt unter der Floskel „Old-for-Old Program“. Für die im Rahmen des Seniorenprogramms gewonnenen Organe oder für vorgeschädigte sog. ‚marginale Organe‘ (z.B. Fettlebern, Raucherlungen, Organe mit Konservierungsschäden) gelten die sog. erweiterten Spenderkriterien (‚extended criteria donor‘). Mitunter werden sie als „eingeschränkt vermittelbare Organe“ (S. 24) über eine sog. modifizierte Warteliste oder ein „beschleunigtes Vermittlungsverfahren“ (S. 25) verteilt. Seitdem die Altersgrenze für Organspender aufgegeben wurde, steigt das Alter von Organspendern im Eurotransplant-Verbund kontinuierlich an. 2023 lag das Medianalter bei 57 Jahren (Deceased donors used, median age, by year, by donor country). Auch in Deutschland sind etwa ein Drittel aller Organspender älter als 65 Jahre. 2023 betrug das Höchstalter von Lungenspendern 87 und das von Leberspendern 89 Jahre (S. 65).
Vor diesem Hintergrund wird plausibel, warum im Gesetzentwurf zur Einführung der Widerspruchslösung (BT Drs. 20/12609) der demografische Wandel ins Feld geführt wird. Die politisch beabsichtigte Erhöhung der Spenderzahlen wird nicht zuletzt auch mit einer abstrusen Methusalem-Vision begründet – allerdings ohne zu problematisieren, was es für alte Menschen bedeutet, die extrem invasive und mit schweren Nebenwirkungen (z.B. Krebs) verbundene Transplantation zu bewältigen:
„Es ist zu erwarten, dass mit dem steigenden Lebensalter der Bevölkerung auch immer mehr Menschen auf die Wartelisten für ein postmortal gespendetes Organ aufgenommen werden, weil sie wegen einer lebensbedrohlichen Erkrankung ein Organ benötigen.“ (S. 16 f.)
Für die Autoren des Gesetzentwurfes scheint eine besondere Zielgruppe die ältere Generation zu sein: Spender von ‚marginalen Organen‘, ebenso wie ihre Empfänger. Der Verdacht liegt nahe, dass es angesichts der geringeren Lebenserwartung nach einer Transplantation im höheren Alter nicht zuletzt auch um eine Steigerung der Zahl von Transplantationsoperationen geht. Der moralische Legitimationsversuch für die geforderte Widerspruchslösung – der „Tod auf der Warteliste“ – blendet im öffentlichen Bewusstsein den nicht geringen Anteil älterer potenzieller (‚Marginal‘-)Organempfänger aus, so dass in den Werbekampagnen für Organspende nichts über die verminderte Lebensqualität und die sehr viel höheren Sterberaten von Patienten nach einer Marginalverpflanzung zu erfahren ist.
Widerspruchslösung – das Ende der kostspieligen Organspende-Werbekampagnen: Die Unwissenheit über den Unterschied zwischen einer spendezentrierten Intensivtherapie und einer patientenzentrierten Sterbebegleitung wird strukturell verankert
Die im Gesetzentwurf genannte, vermeintlich hohe Organspendebereitschaft in der deutschen Bevölkerung (84 Prozent) dient als Schlüsselargument für die Einführung der Widerspruchslösung. Doch wie das Ergebnis der Studie von Elias Wagner, Georg Marckmann und Ralf J. Jox zeigt, beruht die von der BZgA ermittelte positive gesellschaftliche Einstellung zur Organspende auf großen Wissenslücken: Die Hälfte der Befragten war nicht einmal mit dem Konzept des Hirntodes vertraut und nur 22 Prozent wussten, dass eine Organspende nur unter der Voraussetzung einer Intensivtherapie realisierbar ist. Auch lehnt die große Mehrheit der Studienteilnehmer die Reanimation eines im Sterben begriffenen Menschen ab. Diese Einstellung widerspricht zutiefst der vermeintlich großen Organspendebereitschaft, denn schließlich können im Rahmen des spendezentrierten Behandlungskonzepts Wiederbelebungsmaßnahmen ergriffen werden.
Zu befürchten ist: Die Einführung der Widerspruchslösung mit dem politisch gesteckten Ziel „Erhöhung von Spenderzahlen“ dürfte das in der Bevölkerung allgemein herrschende Informationsdefizit noch weiter vergrößern.
Die Widerspruchslösung: Der staatliche Imperativ ‚Organ- und Gewebespende‘ – der Begriff „Spende“ ist zu streichen
Die Widerspruchslösung würde die Begrifflichkeit „Organ- und Gewebespende“, also das Leitmotiv der Gabe, hinfällig machen. Wie einst in autoritären Regimen der Ostblockstaaten beruht diese Regelung auf einer staatlich dekretierten Vergesellschaftung des Körpers sterbender Patienten zum Zweck der therapeutischen Verwertung. So waren schon in der DDR alle Bürgerinnen und Bürger potenziellen Kandidaten für eine Explantation, es sei denn, wie es in der Transplantationsgesetzgebung der DDR von 1975 § 4 hieß, sie hatten „zu Lebzeiten keine anderweitigen Festlegungen getroffen“.
Auch die vom Bundesrat geforderte Widerspruchslösung verlangt im Namen eines Solidaritätsanspruchs, sich als sterbender Patient der medizinischen Instrumentalisierung opfern zu müssen.