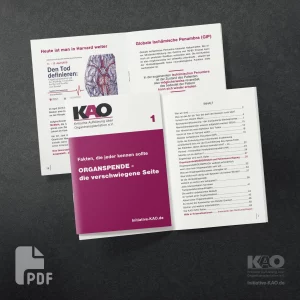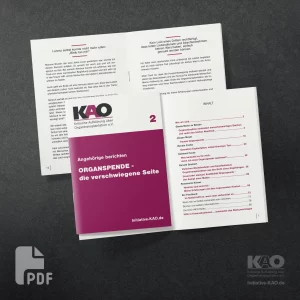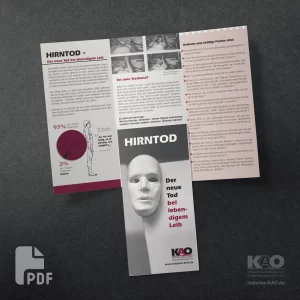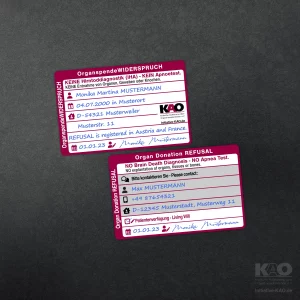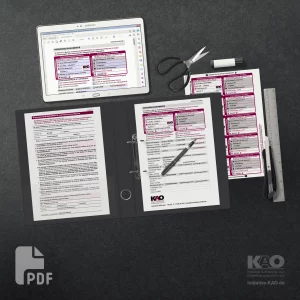Dieses Referat wurde am 27.05.2005 im Rahmen einer Podiumsdiskussion auf dem 30. Evangelischen Kirchentag in Hannover gehalten.
Der Rahmen dieses Kirchentags in Hannover 2005, der uns auffordert, die Normen, nach denen wir leben, uns von unseren Kindern morgen hinterfragen zu lassen, ist Anlass genug, den Titel dieser OrganspendeVeranstaltung „Leben spenden“ ernster zu nehmen, als bisher üblich.
Denn immer noch schlagen wir uns mit der Diskrepanz herum, dass fast alle Menschen in Befragungen für die Organspende sind, gleichwohl aber nur 12 % einen entsprechenden Ausweis haben und 40′% der befragten Angehörigen ihre Zustimmung zur Organspende verweigern. Ich will mich hier zum Sprachrohr der schweigenden und abstinenten Mehrheit machen, zu der ich im übrigen auch gehöre, um auch dieser Mehrheit einen Zugang – einen anderen Zugang – zur Organspende zu eröffnen.
Gerade diese erwähnte Diskrepanz, also das Misstrauen der Mehrheit gegen die Organspende, sollte vor 10 Jahren mit dem ransplantationsgesetz und dem Hirntodkonzept ausgeräumt werden. Ich selbst war damals bei den Bundestagsanhörungen beteiligt. Ich habe noch einen Brief vom damaligen Gesundheitsminister Horst Seehofer, dessen Ernsthaftigkeit des Ringens um den richtigen Weg mich genauso beeindruckt hat wie das des ganzen Bundestages, das in der Zweidrittel/Eindrittel-Abstimmung seinen Ausdruck gefunden hat. In diesem Brief vom 27.09.1995 – für mich ein historisches Dokument – heißt es: „Ich weiß, dass die Problematik des so genannten Hirntods vor allem darin liegt, dass die ärztliche Feststellung des Todes nicht mit der seit Jahrtausenden überlieferten sinnlichen Wahrnehmung vom Tod übereinstimmt. Den Menschen wird hier ein großes Vertrauen in die ärztliche Kunst und deren apparative Unterstützung abverlangt.“ Aus fast 10-jähriger Distanz kommt eigentlich schon in diesen Formulierungen das unvermeidliche Scheitern des Hirntod-Konzepts zum Ausdruck.
Schon damals haben viele – wie sich heute zeigt, offenbar zu Recht – vorausgesagt, dass das Hirntod-Konzept das Misstrauen der Bürger gegen diese Art von Medizin nur verstärken kann. Die wichtigsten Argumente gegen das Hirntod-Konzept waren damals:
1. Diagnostisch werden hier einseitig nur die Todeszeichen, nicht aber die Lebenszeichen des Patienten berücksichtigt.
2. Insofern wird hier einseitig nur defektmedizinisch, nicht aber vollständig beziehungsmedizinisch gedacht und gehandelt.
3. Mit diesem Konzept beanspruchen die Mediziner nicht nur die medizinische (was in Ordnung ist), sondern auch die lebensweltlich-kulturellreligiöse Deutungsmacht über die Bedeutung von Leben, Sterben und Tod, nehmen sie den Bürgern und auch den Kirchen ohne Rechtfertigung und daher verfassungswidrig weg, was damals die Kirchen zwar mit sich machen ließen, nicht aber die Bürger.
4. Die Mediziner folgen damit einem merkwürdig künstlichen, falschen oder zumindest überholten cartesianischen Menschenbild vom Menschen als einem Hirnwesen, für den sein Leib nur ein Anhängsel ist, was unseren beiden Denktraditionen, der griechischen ebenso wie der biblischen, widerspricht.
5. In den Augen der Bevölkerungsmehrheit, die sich ihre „seit Jahrtausenden überlieferte sinnliche Wahrnehmung vom Tod“ um keinen Preis der Welt von noch so vielen naturwissenschaftlichen Beweisen wegnehmen lässt, verfolgen die Mediziner mit ihrer Erfindung des Hirntodes eine Absicht, die verstimmt, nämlich die Absicht, den schwarzen Peter dieses Problems von sich weg- und zu den Angehörigen und den Bürgern herüberzuschieben. Denn in dem Maße, wie die Mediziner sich mit Hilfe dieses Konzepts entlasten, wonach sie die Entnahmeoperation jetzt nur noch an einer angeblichen Leiche vornehmen, in demselben Maße belasten sie damit insbesondere die Angehörigen, die von ihrem zwar sterbenden, aber mit normalen Vitalfunktionen als lebend erlebten Familienmitglied sich aufgefordert wissen: „Lass mich im Sterben nicht allein. Überlasse mich nicht der Verwertung. Bleibe bis zu meinem Tode bei mir“, während der Arzt den Angehörigen aufklärt „Was du da erlebst, ist Unsinn, ist ein Irrtum, weil wir naturwissenschaftlich bewiesen haben, dass dein Familienmitglied tot ist“ um dann hinter dem Rücken des nach Zustimmung weggeschickten Angehörigen selbst den Patienten liebevoll wie einen Lebenden zu behandeln und ihn erst mit dem Abklemmen der Herzgefäße während der Entnahme-Operation keineswegs einen Hirntod, sondern eine ganz normalen Herztod sterben lassen.
All diese Gründe haben an Triftigkeit in den letzten 10 Jahren eher zugenommen, einmal weil wir über breitere Erfahrungen verfügen, zum anderen, weil wir uns allgemein kulturell weiterentwickelt haben und zum dritten, weil die Hitze des damaligen Dogmenstreits verflogen und die dadurch bewirkten Denkverbote wirkungsloser geworden sind.
Dies will ich mit meinem folgenden Vorschlag nutzen, ein Vorschlag, der neue Wege eröffnet und der einer Ethik der gerechten Verteilung der Anteile des schwarzen Peters folgt:
In dem Formular zur Beantragung des Organspenderausweises wird jedem Bürger der jetzige Entscheidungsweg belassen, jedoch um eine weitere Wahlmöglichkeit ergänzt – etwa mit folgenden Worten: „Weil ich das Hirntod-Konzept für falsch, unmenschlich, verfassungswidrig oder unmoralisch halte, bin ich zur Spende meiner Organe zwar bereit, aber nur unter der Bedingung, dass alle Beteiligten davon ausgehen, dass ich nicht nur bis zu meinem so genannten Hirntod, der real nur als Hirntod-Syndrom existiert1)[1], sondern bis zu meinem Herztod ein lebender Mensch und nicht aus der Gemeinschaft der Lebenden ausgeschlossen bin.“ Das bedeutet zwar für die Ärzte eine moralische Erschwerung, aber für mich genauso; denn ich kann eine Spende, ein Geschenk, ein Opfer, eine Gabe nicht als Leiche, sondern nur als lebender Mensch geben; nur als lebender Mensch kann ich mich von einem Anderen dazu bestimmen lassen. Insofern kann es nur Lebendspenden geben. Und schließlich: ob der Arzt mir nur eine Niere entnimmt oder ob er mit dem Abklemmen der Herzgefäße meinen ohnehin sich vollziehenden, oft sogar schon überfälligen Sterbeprozess gewähren lässt – in jedem Fall begeht er im herkömmlichen Sinne eine strafbare Körperverletzung, gerechtfertigt nur aufgrund meiner frei gewählten Verantwortung und auch nur dann, wenn ich mit meiner Verantwortung auf die vitale Not eines konkreten Anderen antworte, mich einer Bedeutung für Andere aussetze, was mich in der letzten Lebensphase meines Sterbens ohnehin mehr bestimmt als meine Selbstbestimmung.
Mit diesem fairen Lastenausgleich zwischen allen wäre Vertrauen wieder hergestellt. Ärzte, Pflegende, Spender, Angehörige und Empfänger wären wieder ehrlich, die Spendenbereitschaft würde erheblich steigen. Und alle könnten mit diesem Kompromiss für die heutige Übergangszeit leben, bis der technische Fortschritt die trotz allem immer fragwürdige Organspende überflüssig gemacht haben wird.
Die nicht nur, aber vor allem biblische Variante der Ethik-Begründung, warum hier kein Tötungsdelikt vorliegt, lautet: Es ist der äußerste, daher seltene, jedoch unvermeidlich notwendige Horizont einer freien Verantwortungs-Ethik, mein Leben stellvertretend für den Anderen, vom Letzten her, zu geben, also auch mein Sterben (als Leben) zunächst nicht von der Furcht vor meinem eigenen Tod, sondern (da der Tod immer der Tod des Anderen ist) von meiner Furcht um den Tod des Anderen bestimmen zu lassen und mein Leben (nicht meine Leiche) für den Anderen zu geben.
Zum Schluss – und hier ganz nebenbei – würde ein ähnlicher Gedankenweg auch zur Begründung der Erweiterung des Kreises der Berechtigten zur Lebendspende im heutigen, engeren Sinne beitragen: In unserer kulturellen Weiterentwicklung sind Tendenzen mit Händen zu greifen, wonach wir postmodernen Menschen – nicht nur als Gegenreaktion gegen die Globalisierung – uns auch wieder mehr, wie in der Vormodeme, im lokalen Nahraum, im dritten Sozialraum, in der Nachbarschaft organisieren und uns von daher bestimmen lassen. Nachbarschaft ist aber menschheitsgeschichtlich immer schon als derjenige einzige Sozialraum definiert, der für das Helfen der Bürger in überdurchschnittlichen Not- und Krankheitsfällen zuständig ist. Die Wiederbelebung des Nachbarschaftsraums wird aber schon allein durch die schier unendliche Zunahme der Alterspflegebedürftigen für die Bürger unvermeidlich. Es nehmen also die guten Gründe auch dafür zu, den Kreis der besonders verbundenen Personen für die Lebendspende auf den Sozialraum der Nachbarschaft zu erweitern.
In beiden Perspektiven lohnt es sich daher, den Gesetzgeber zu ermutigen, das Transplantationsgesetz – über die damalige hektische Notoperation von 1997 hinaus – neu zu überdenken und zugleich verfassungskonformer zu machen; denn es darf nur darum gehen, Leben zu spenden.
Andreas Zieger: Medizinisches Wissen und Deutung in der Beziehungsmedizin‘ – Konsequenzen für Transplantationsmedizin und Gesellschaft, in: A. Manzei u. a. (ed.): Transplantationsmedizin – Kulturelles Wissen und gesellschaftliche Praxis (im Erscheinen). ↑