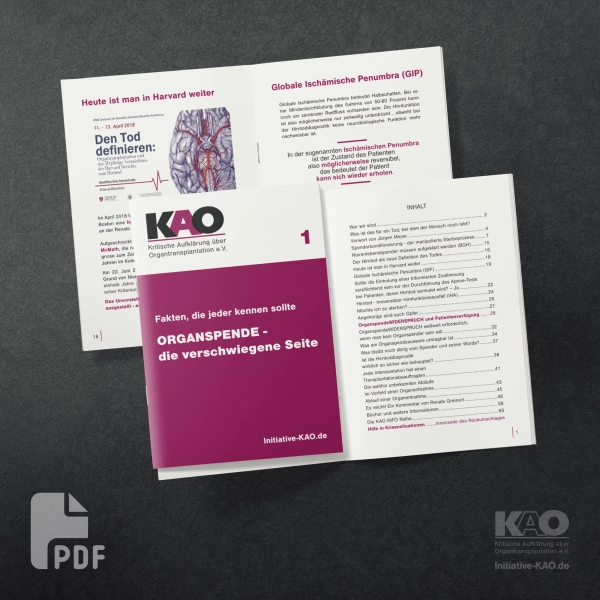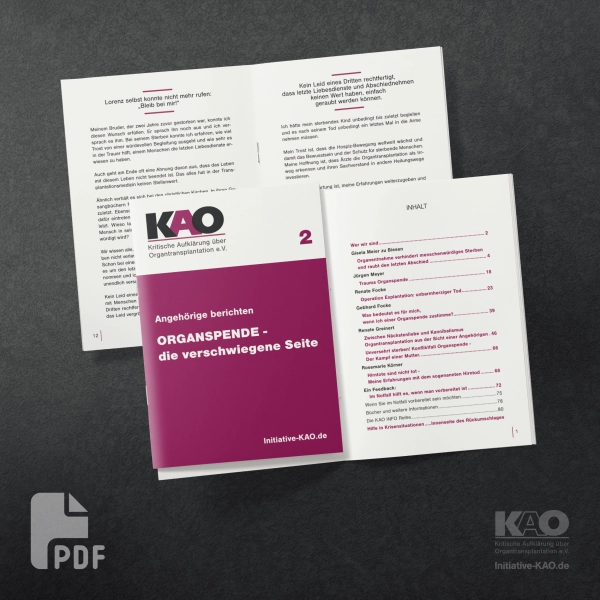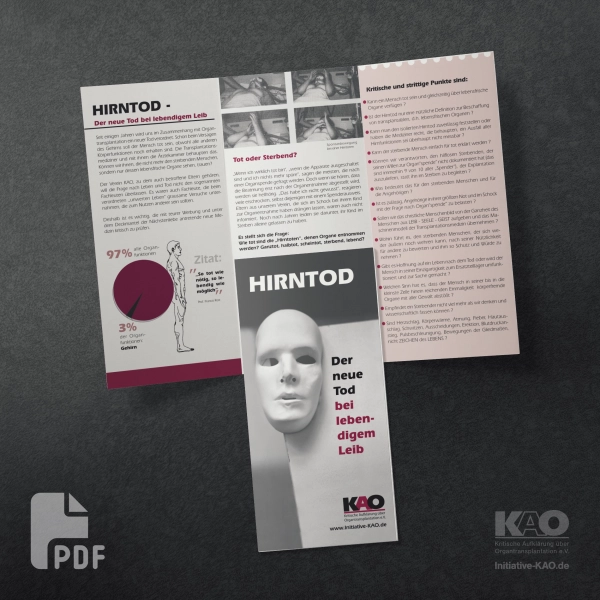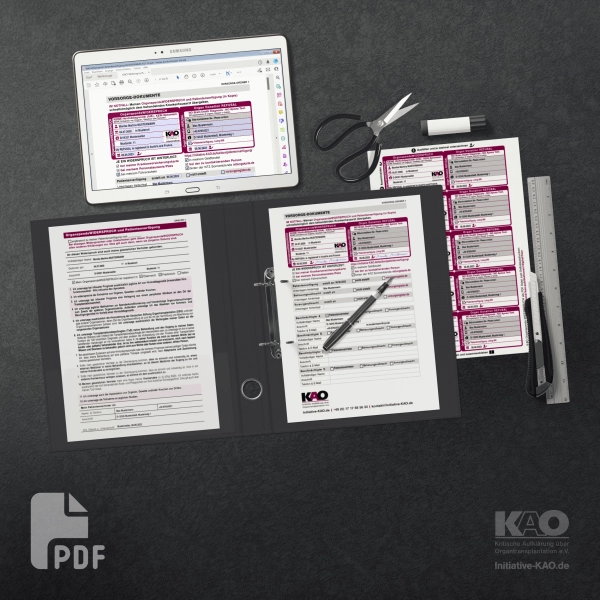Konzepte zum Umgang mit der Organspende von lebenden Hirntoten
Im April 2018 veranstaltete das Center for Bioethics at Harvard Medical School in Boston, USA, anlässlich des 50. Jahrestags der Hirntod-Definition eine internationale Konferenz. Die Beiträge, die im Hastings Center Report vom November 2018 veröffentlicht wurden, geben einen guten Eindruck vom derzeitigen internationalen Meinungsbild zum Hirntod:
- Fast alle Referenten räumten ein, dass Hirntote noch leben.
- Kein Referent sprach sich grundsätzlich gegen Organentnahmen von Hirntoten aus.
- Fast alle Referenten vertraten ein alternatives Verfahren zur Organbeschaffung, das sie für ethisch unbedenklich hielten.
1 Wann ist der Mensch ein Mensch? – „The higher brain death“
Während die Harvard-Kommission zur Untersuchung der Definition des Hirntods 1968 ihre Definition nicht begründete, bekannte sich ihr Vorsitzender, der Anästhesist Henry K. Beecher, bereits im Jahr 1971 zum „Higher brain death“, frei übersetzt „Tod des höheren Gehirns“: Ein Mensch ist tot, wenn er seine Persönlichkeit und seine Bewusstseinsfähigkeit unwiederbringlich verloren hat.[1] Diese Position wurde 1971 auch von dem britischen Neuropsychiater J. B. Brierley[2] vertreten und in Amerika unter anderem von dem Ethiker Robert Veatch und der Kinderärztin Lainie Ross weiter ausgebaut. [3],[4]
Die Ansicht ist umstritten. Es ist gut nachvollziehbar, dass Patienten, die die Möglichkeit verloren haben, Bewusstsein zu äußern, zu denken und zu planen, nicht mehr sinnvoll leben können und ein Recht auf Sterben haben. Etwas ganz anderes ist es, ihnen das Menschsein rundweg abzusprechen und sie zu rechtlosen Organspendern zu erklären. Die Position hat zudem einen erheblichen Schönheitsfehler: Wenn wir Hirntote nicht mehr als Menschen anerkennen, ist es naheliegend, dies auch mit Kindern zu tun, die ohne Großhirn geboren wurden; und dann mit Dementen, Behinderten, … Eine klare Grenze ist nach dem Dammbruch nicht mehr zu ziehen, gerade in Deutschland ist diese Position nicht vertretbar.
2 Dürfen wir für die Organspende töten? – „Justified killing“
2003 regte der Bostoner Anästhesist und Ethiker Robert Truog an, dass Patienten, die schwerwiegende neurologische Defizite erlitten haben und sich im unumkehrbaren Sterbeprozess befinden, auf eigenen Wunsch Organe spenden können, auch wenn sie noch nicht für tot erklärt worden sind.[5] 2008 prägte er zusammen mit dem amerikanischen Ethiker Franklin Miller den Begriff „justified killing“.[6] Die beiden räumten ein, dass Hirntote noch leben, sahen es aber in einer Güterabwägung als gerechtfertigt an, die unheilbar Kranken mit der Organentnahme zu töten. Das Konzept wird vor allem in den USA diskutiert[7],[8] und auch in Deutschland als Außenseitermeinung vertreten.[9] In die Erklärung des Deutschen Ethikrats von Februar 2015 wurde es in abgewandelter Form als Minderheitenvotum aufgenommen.[10] Dies war schon sehr bemerkenswert, denn deutsche Transplantationschirurgen lehnen „justified killing“ bisher entschieden ab.
Tatsächlich ist schwer zu vermitteln, dass Schwerkranke um den Sterbeprozess gebracht werden, um den Tod anderer Schwerkranker herauszuzögern. Insbesondere Ärztevertreter wehren sich erbittert gegen die Vorstellung, sie würden den Organspender mit der Organentnahme töten, aus welchen ethischen Gründen auch immer.
3 Wie sicher ist der klinische Tod? – „Non-heart-beating Donors“
Der Mangel an Spenderorganen hat die ursprüngliche Methode der Organgewinnung wieder ins Spiel gebracht: Organentnahme nach Herztod. Wenn unheilbar Kranke in eine Organspende einwilligen, wird ihre Therapie nach Absprache mit ihnen eingestellt und ihnen erlaubt, unter kontrollierten Bedingungen zu sterben. Auf eine Wiederbelebung wird verzichtet, und nach einer „No touch“-Zeit von 2 – 10 Minuten werden die Organe entnommen.[11] Das Problem ist, dass mit dem Herzstillstand die Durchblutung der Organe zusammenbricht und die Organe ohne Durchblutung nicht lange brauchbar bleiben. Daher wird der Tote nur sehr kurze Zeitz in Ruhe gelassen, dann wird er je nach Protokoll entweder erneut reanimiert, oder seine Organe werden mit konservierender Flüssigkeit durchspült, oder die Organentnahme wird unverzüglich begonnen. In der Praxis werden meist nur die Nieren verwertet, weil andere Organe nur kurze Ischämiezeiten überstehen. Die unter den Bezeichnungen NHBD (Non-heart-beating Donation) und DCD (Donation after the Circulatory Determination of Death)[12] bekannte Praxis ist ethisch heftig umstritten, da der genaue Zeitpunkt des Todes nicht bekannt ist und eine Reanimation unter Umständen noch erfolgreich sein könnte. So weist unter anderem der amerikanische Kinderarzt Ari Joffe darauf hin, dass Spender ohne Herzschlag zur Zeit der Organentnahme durchaus noch leben können.[13]
In den USA befürworten bekannte Neurologen wie James Bernat und Alan Shewmon[14] diese Praktik der Organgewinnung. Von 1993 bis 2018 wurden dort 16.000 Organspenden nach dem DCD-Protokoll durchgeführt, das waren 10% aller postmortalen Organspenden. In Europa sind DCD-Spenden unter anderem in Norwegen, Schweden, Finnland, Belgien, den Niederlanden, Großbritannien, Irland, Frankreich, Tschechien, Österreich, Spanien und der Schweiz erlaubt. Die No-touch-Zeiten variieren zwischen 5 Minuten (Frankreich) und 20 Minuten (Italien). 1998 legte Eurotransplant fest, dass eine Asystolie über 10 Minuten dem Hirntod gleichzusetzen sei. In Deutschland ist weiterhin eine Wartezeit von über drei Stunden vorgeschrieben.
3.1 Unkontrollierte DCD (Maastricht II):
In Spanien ist die unkontrollierte DCD perfektioniert: Außerhalb des Krankenhauses begonnene ungeplante Wiederbelebungen werden so lange nach den besten Standards fortgeführt, bis der Patient im zuvor alarmierten Krankenhaus eintrifft. Dort wird von Experten abgeschätzt, ob Erfolgsaussichten bestehen, und bei Aussichtslosigkeit die Reanimation abgebrochen. Nach einer Wartezeit von 5 Minuten werden organerhaltende Maßnahmen begonnen, die bis zur Organentnahme fortgeführt werden. Dass in Spanien die Widerspruchslösung gilt, vereinfacht das Verfahren, die Zustimmung der Angehörigen wird aber in der Regel angestrebt.[15]
3.2 Kontrollierte DCD (Maastricht III):
In der Schweiz werden 11% der Organspenden als kontrollierte DCD durchgeführt: Bei unheilbar kranken Palliativpatienten wird die Einwilligung in die Beendigung der Therapie und in die Organspende eingeholt. Viele Patienten lassen sich darauf ein, weil ihr Tod so einen Sinn bekomme und anderen helfe. Nun wird der Patient in den Operationsbereich gebracht, gegebenenfalls in Begleitung seiner Angehörigen, und die Therapie wird eingestellt. Das Entnahmeteam wartet auf den Herzstillstand, schickt dann die Angehörigen heraus und beginnt nach einer Wartezeit von fünf Minuten mit Reanimationsmaßnahmen, damit die Organe bis zur Entnahme nicht zu viel Schaden nehmen.[16] Zur rechtlichen Absicherung wird direkt vor der Organentnahme wird eine vereinfachte Hirntodfeststellung durchgeführt, die aber einige Hirntodkriterien ignoriert und von amerikanischen Transplantationsexperten wie James Bernat nicht anerkannt wird[17]
Aus palliativmedizinischer Sicht lehnt die deutsche Kulturwissenschaftlerin Anna Bergmann die kontrollierte DCD entschieden ab. Sie beanstandet, dass die Rolle der Palliativmedizin dabei für die Transplantationsmedizin instrumentalisiert und regelrecht pervertiert wird und dass der Sterbeprozess in der entscheidenden Phase brutal abgebrochen wird[18].
3.3 DCD und Euthanasie
Eine Abwandlung der DCD ist in Belgien und den Niederlanden die Organspende in Verbindung mit der Sterbehilfe. Patienten, die auf eigenen Wunsch mit ärztlicher Hilfe sterben, können zuvor in eine Organspende einwilligen, die dann unter optimalen Bedingungen durchgeführt wird. Auch hier wird eine Latenzzeit von nur wenigen Minuten eingehalten. Bemerkenswert ist, dass nur ein sehr kleiner Teil des Euthanasiepatienten einer Organentnahme zustimmt.[19]
4 Donation before circulatory death
2010 veröffentlichte der amerikanische Transplantationschirurg Paul Morrissey ein weiteres Konzept: Bei Patienten, die unheilbar krank sind und persönlich oder nach Versicherung der Angehörigen in eine Organspende einwilligen, entnimmt er in Narkose die Nieren. Erst dann stellt er die lebenserhaltende Therapie ein. Der Patient stirbt nicht an der Organentnahme.[20] Der amerikanische Neurologe James Bernat sieht in der Praxis eine Verletzung der Dead Donor Rule, der Vereinbarung, dass Organspender tot sein müssen[21].
5 Ist die Transplantationsmedizin vielleicht sogar entbehrlich?
Auf der Hirntodkonferenz ließen der amerikanische Kinderarzt David Magnus[22] und der amerikanische Sozialmediziner und Philosoph Michael Nair-Collins[23] auch kritische Töne anklingen: Sie wiesen darauf hin, dass nur vergleichsweise sehr wenige Patienten von Organtransplantationen profitieren und dass das in die Transplantationsmedizin investierte Geld in der Gesundheitsvorsorge für wesentlich mehr Lebensqualität sorgen könnte. Michael Nair-Collins führte vor allem aus, dass Organspenden nur legal sind, wenn die Spender bzw. die Öffentlichkeit über den Zustand „Hirntoter“ umfassend aufgeklärt werden.
Quellen:
- Beecher, Henry K.; Dorr, H. I.: The new definition of death: Some opposing views. Internationale Zeitschrift für klinische Pharmakologie, Therapie und Toxikologie 5 (1971, 2, November), 120 – 124. ↑
- Brierley, J. B.; Graham, D. I.; Adams, J. H.; Simpsom, J. A.: Neocortical death after cardiac arrest: A clinical, neuropsychological, and neuropathological report of two cases. The Lancet 298 (1971, 11.9., 7724), 560 – 565. ↑
- Veatch, Robert M.; Ross, Lainie F.: Defining death: The case for choice. Washington, 2016. ↑
- Ross, Lainie Friedman: Respecting choice in definitions of death. Hastings Center Report 48 (2018, 6, November, S4), S53-55. ↑
- ruog, Robert; Robinson, Walter: Role of brain death and the dead-donor rule in the ethics of organ transplantation. Critical Care Medicine 31 (2003, 9, September), 2391 – 2396. ↑
- Miller, Franklin G.; Truog, D. Robert: Rethinking the ethics of vital organ donations. Hastings Center Report 38 (2008, 6, November), 38 – 46. ↑
- Rodriguez-Arias, David: The dead donor rule as policy indoctrination. Hastings Center Report 48 (2018, 6, November, S4), S39-42. ↑
- Shah, Seema K.: Rethinking brain death as a legal fiction: Is the terminology the problem? Hastings Center Report 48 (2018, 6, November, S4), S49-52. ↑
- Stoecker, Ralf: Der Hirntod aus ethischer Sicht. Vortrag, Berlin, 21.3.2012. ↑
- Woopen, Christiane; Catenhusen, Wolf-Michael; Dabrock, Peter; Taupitz, Jochen: Hirntod und Entscheidung zur Organspende. Stellungnahme. Deutscher Ethikrat, 24.2.2015, 189 Seiten. Verfügbar unter: www.ethikrat.org/publikationen/ ↑
- Manara, A. R.; Murphy, P. G.; O’Callaghan, G.: Donation after circulatory death. British Journal of Anaesthesia 108 (2012, S1), i108-i121. ↑
- Bernat, James L.: Conceptual issues in DCDD donor death determination. Hastings Center Report 48 (2018, 6, November, S4), S26-28. ↑
- Joffe, Ari: DCDD donors are not dead. Hastings Center Report 48 (2018, 6, November, S4), S29-32. ↑
- Shewmon, D. Alan: „Brainstem death“, „brain death“ and death: A critical re-evaluation of the purported evidence. Issues in Law and Medicine 14 (1998, 2, Herbst), 125 – 142. ↑
- Ortega-Deballon, Ivan; Rodriguez-Arias, David: Uncontrolled DCD: When should we stop trying to save the patient and focus on saving the organs? Hastings Center Report 48 (2018, 6, November, S4), S33-35. ↑
- Lenherr, Renato; Krones, Tanja: Das Zürcher DCD-Programm: Geschichte, ethische Aspekte und praktische Erfahrungen. Bioethica Forum 9 (2016, 1), 9 – 16. ↑
- Dalle Ave, Anne L.; Bernat, James L.: Using the brain criterion in organ donation after the circulatory determination of death. Journal of Critical Care 33 (2016, Juni), 114 – 118. ↑
- Bergmann, Anna: Das „gerechtfertigte Töten“ für die Lebensrettung anderer Patienten. Praxis Palliative Care 44 (2019), 47 – 48. ↑
- imabe: Belgien: Mehr Organspenden nach aktiver Sterbehilfe sollen Engpässe verkürzen. Mai 2017, www.imabe.org/index.php?id=23953 ↑
- Morrissey, Paul E.: The case of kidney donation before end-of-life care. American Journal of Bioethics 12 (2012, 6, Juni), 1 – 8. ↑
- Bernat, James L.: Life or death for the dead-donor rule? New England Journal of Medicine 369 (2013, 14, Oktober), 1289 – 1291. ↑
- Magnus, David: A defense of the dead donor rule. Hastings Center Report 48 (2018, 6, November, S4), S36-38. ↑
- Nair-Collins, Michael: The public’s right to accurate and transparent information about brain death and organ transplantation. Hastings Center Report 48 (2018, 6, November, S4), S43-45. ↑