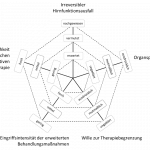Im Jahre 2013 sagte der evangelische Klinikpfarrer Rolf-Martin Turek aus Leipzig in einem Vortrag mit dem Titel „Der verweigerte Dialog“, zwei Gruppen von an der TP-Medizin Beteiligten hätten keinen Zugang zur Öffentlichkeit und zur Gesetzgebung, nämlich die kritischen Angehörigen und die Intensivteams. Wir als Angehörige äußern schon seit vielen Jahren unsere Kritik an dem herrschenden TP-System. Entsprechend gespannt waren wir, als wir auf das Positionspapier vom „Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe e.V. (DBfK) – Bundesverband“ vom 08.02.2014 stießen. Wir hofften auf Gemeinsamkeiten, fanden aber hauptsächlich Gemeinplätze und keine kritische Auseinandersetzung mit den für die Pflegenden belastenden Aspekte dieser Medizin.
Schon in Punkt 1 („Autonomie des Spenders“) kommt das Wort Solidarität vor, verstanden als bewusster Akt eines Spenders gegenüber einem Empfänger; wiederholt wird der Begriff in Punkt 3. Die Solidarität ist hier ebenso eine Einbahnstraße wie der Begriff der „Nächstenliebe“, den die Kirchen stattdessen verwenden. Es wird kein Gedanke daran verschwendet, dass man als solidarisches Handeln auch verstehen könnte, dass jemand auf ein sog „neues Organ“ verzichtet, um dem „Spender“ ein schreckliches Sterben auf dem OP zu ersparen.
Eine Spende ist etwas Freiwilliges, für die sich ein Mensch gut informiert und im vollen Bewusstsein entscheidet. In neun von zehn Situationen, in denen es zur Organentnahme kommt, kann nicht von einer Spende und erst recht nicht von der Autonomie des Spenders die Rede sein. Selbst in dem einen Fall, in dem ein Ausweis vorliegt, ist der Betreffende nur einseitig in Hinblick auf den Empfänger informiert. Bei neun von zehn Menschen wird nach dem mutmaßlichem Willen gehandelt. Sie haben keine Möglichkeit mehr sich zu äußern, sich zu wehren, sie werden zu „Spendern“ gemacht. Das ist eine Ungeheuerlichkeit, handelt es sich doch bei ihnen um den Prozess des Sterbens, falls die Diagnose überhaupt richtig ist. Die Angehörigen, denen die Entscheidung aufgebürdet wird, (die zur Einwilligung genötigt werden), sind in der Regel im Schock, d.h. sie sind handlungsunfähig und ausgeliefert. Sie sind zu schützen. Eine Aussage im Schock hat keine Gültigkeit. Die Transplantationsmedizin beruht auf dem Ausnutzen zweier wehrloser Gruppen, nämlich den Patienten und ihren Angehörigen.
In Punkt 2 („Organtransplantation“) wird „ein Konzept von Patientenedukation“ gefordert, ausdrücklich für die Empfänger und ihre Angehörigen …“um mit der Situation, erfolgreich eine Spenderorgan erhalten zu haben, aber dennoch dauerhaft chronisch krank zu sein, umgehen und leben zu können.“ Warum wird nicht einfach gefordert, dass die TP-Mediziner ihre Patienten gründlich und sachgerecht über die absehbaren Folgen einer Organübertragung informieren – wozu diese übrigens laut Gesetz sowieso verpflichtet sind? Warum wird diese „Edukation“ nicht auch für die Menschen gefordert, die einen Organspendeausweis ausfüllen sollen?
In Punkt 3 („Spendenbereitschaft“) wird die Einrichtung von „Spenderfamilien“ gefordert, die in gegenseitiger Solidarität und Bekanntschaft Organe spenden und empfangen wollen. Das würde bedeuten, dass die TP-Medizin regional organisiert werden müsste – wie soll man sich sonst kennen lernen? Angesichts der europäischen Dimension der Transporte völlig weltfremd. Aus gutem Grund wird bislang übrigens vermieden, dass Spenderangehörige und Empfänger sich treffen. Die gegenseitigen Erwartungen würden in vielen Fällen nicht erfüllt werden können. Beispiel: Der hat die von meinem Angehörigen entnommene Leber bekommen und trinkt trotzdem weiter!?
In Punkt 4 („Patientenverfügung vs. Organspendeausweis“) wird im letzten Satz eine Forderung aufgestellt, die weder sprachlich noch inhaltlich verständlich ist. Gemeint ist wohl, dass die Menschen sich bewusst werden sollen, dass eine Patientenverfügung, in der intensivmedizinische Lebensverlängerung ausgeschlossen wird, und die Zustimmung zur Organspende sich ausschließen. Die daraus zwingend erforderliche Notwendigkeit, vor der Abgabe solcher Erklärungen neutral aufgeklärt zu werden, wird nicht erwähnt – stattdessen wird davon geredet, dass diese „aufeinander abgestimmt werden“ sollen – was immer das heißen mag.
In Punkt 5 („Verteilungsgerechtigkeit“) wird eine verstärkte Kontrolle und Transparenz bei der Verteilung der Organe und Gewebe gefordert. Dem ist natürlich zuzustimmen; allerdings sind europäische Abkommen dazu kaum geeignet.
In Punkt 6 geht es endlich um das Anliegen, das beim DBfK im Mittelpunkt stehen müsste, der Situation der Pflegenden. Der Analyse ist zuzustimmen, nicht jedoch den daraus resultierenden Forderungen. Es geht um den eigenen Ethikkodex, an dem der DBfK sich messen lassen muss; Er benennt ja selbst die Unvereinbarkeit von Kodex und Pflege sog. Hirntoter, aber zieht für die Pflegenden die falschen Konsequenzen. Diese werden aufgefordert, sich anzupassen, mitzumachen, Nur in einem Nebensatz wird eine kritische Hirntoddiskussion gefordert, obwohl diese der Angelpunkt der gesamten Medizin ist: Fällt die Hirntoddefinition, fällt auch das Transplantationswesen. Es wird noch nicht einmal gefordert, dass die Pflegenden nicht verpflichtet werden dürfen, sich an Organentnahmen zu beteiligen – dann wäre es nicht nötig, …“zum Zweck der eigenen, professionellen Selbstverständigung“ eine bessere Ausbildung zu fordern.
Bremen, im April 2014
Gebhard Focke
PDF Datei:
Stellungnahme zum Positionspapier des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe (DBfK) zu Organspende und Organtransplantation 2014